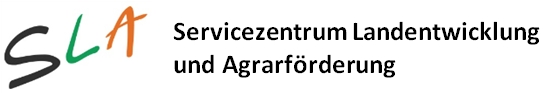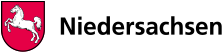Persönliche Angaben und Sammelantrag
Hinweis zur Schlagwortsuche: Um auf einer Webseite Ihren Suchbegriff schnell zu finden, drücken Sie Strg + F bzw. ⌘ + F (Mac) und nutzen Sie dann die Suchleiste, die eingeblendet wird.
Persönliche Angaben
In diesem ersten Abschnitt werden allgemeine Fragen zum Betrieb gestellt. Dieser Teil ist grundsätzlich von allen Begünstigten auszufüllen. Es sind Angaben zur Adresse, zum Festsetzungsfinanzamt für Ihre Einkommensteuer und zur Bankverbindung zu machen. Sofern Sie bereits im Vorjahr am Antragsverfahren teilgenommen haben, werden die Angaben aus dem Vorjahr vorbelegt. Bitte prüfen Sie diese Daten sorgfältig und nehmen Sie ggf. Änderungen, Streichungen oder Ergänzungen vor. Die Änderung einiger Daten ist nur eingeschränkt oder gar nicht in ANDI möglich, da eine Veränderung dieser Daten in der Regel zu einer Neuvergabe einer Registriernummer führt. Die entsprechenden Angaben sind ggf. handschriftlich auf dem Datenbegleitschein zu machen. Sofern Sie sich für eine Authentifizierung über BundID oder MeinUnternehmenskonto (MUK) entschieden haben, nehmen Sie die entsprechenden Änderungen bitte selbst im ERNI-Portal vor.
Bitte beachten Sie: Ein Antrag für die Vergabe einer Registriernummer oder die Änderung einer Registriernummer oder der Stammdaten ist grundsätzlich im Vorfeld der ANDI-Antragstellung über das ERNI-Portal möglich. Für diesen Registriernummern-Antrag wird jedoch ein gewisser Abarbeitungszeitraum benötigt. Bitte bedenken Sie, zur aktuellen Antragstellung die aktuell gültige Registriernummer zu verwenden.
Betrieb, Unternehmenssitz (Ort der steuerlichen Festsetzung bzw. niedersächsische / bremer/ hamburger Adresse)
An dieser Stelle weisen wir darauf hin, dass in diesen Ausführungen der Begriff "Betrieb" mit dem Begriff eines "selbständigen Unternehmens" gleichzusetzen ist und nicht mit dem Begriff einer "unselbständigen Betriebsstätte" verwechselt werden darf.
Betrieb: Die uns vorliegenden Daten zu Ihrem Unternehmenssitz (Name und Anschrift) werden angezeigt. Eine Änderung dieser Daten in ANDI ist nicht möglich, da eine Änderung der Angaben ggf. zu einer Neuvergabe einer Registriernummer führen würde.
Titel und Generation: In diesen Feldern können entsprechende Namenszusätze erfasst werden. Die Erfassung ist direkt im Programm möglich.
In diesen Feldern werden Ihre Kontaktdaten erfasst.
Telefon / Mobil: Die Angabe mindestens einer Festnetz- oder Handynummer ist verpflichtend. Zur schnellen Klärung von Fragen bietet sich oftmals die telefonische Kontaktaufnahme an. Die Angabe einer telefonischen Erreichbarkeit ist mittlerweile auch in den rechtlichen Regelungen als verpflichtend aufgenommen worden. Sie haben die Auswahlmöglichkeit, ob Sie Ihre Festnetz- oder Mobilnummer angeben möchten. Die Angabe beider Nummern ist ebenfalls möglich.
E-Mail-Adresse: Wie in anderen Bereichen auch, nimmt auch bei den Bewilligungsstellen die Kommunikation über E-Mail immer mehr zu. Insbesondere im Rahmen der Einführung neuer Technologien und Anwendungen wie z. B. des Flächenüberwachungssystems (AMS - Area Monitoring System) oder der Foto-App FANi wird diese Kommunikationsform künftig überwiegen, da es auf diese Weise möglich ist, Informationen und Unterlagen schnell auszutauschen, teilweise sogar automatisiert. (Nähere Informationen zum Flächenüberwachungssystem (AMS - Area Monitoring System) finden Sie auch unter "Allgemeine Informationen zum Verfahren des Flächenüberwachungssystems (AMS)" - als Teil der Antragsunterlagen).
Seit 2023 ist die Angabe der E-Mailadresse für alle Begünstigten verpflichtend. Es besteht nicht mehr die Möglichkeit anzugeben, dass keine E-Mailadresse vorhanden ist oder eine vorhandene E-Mail-Adresse nicht angegeben werden soll. Sofern im Vorjahr bereits eine E-Mail-Adresse angegeben wurde, ist diese vorbelegt. Eine Wiederholung im Feld "E-Mail bestätigen" ist dann nicht nötig.
Sofern von Ihnen bisher keine E-Mail-Adresse hinterlegt ist, ist diese anzugeben. Um eventuelle Schreibfehler zu vermeiden, ist eine doppelte Angabe vorgesehen. Ein Kopieren und Einfügen der im ersten Feld eingegebenen E-Mail-Adresse funktioniert daher nicht.
Die Kommunikation im Rahmen des AMS sowie bei der Nutzung der FANi-App soll über E-Mail erfolgen. Sofern Sie Ihre Zustimmung hierfür erteilen, werden Sie automatisiert informiert, wenn sich Änderungen ergeben oder etwas von Ihnen zu veranlassen ist.
Die automatisierte Nutzung erfolgt so:
Die in ANDI angegeben E-Mail-Adresse wird im Bearbeitungssystem hinterlegt.
Besteht bei Nutzung der FANi-App seitens der Bewilligungsstelle und im Verfahren des AMS zu einzelnen Antragsflächen noch Klärungsbedarf, werden konkrete Fotoaufträge in der FANi-App bereitgestellt. Wurde der automatisierten Nutzung der E-Mail-Adresse zugestimmt, wird ein Prozess angestoßen, durch den eine automatisierte E-Mail an Sie versendet wird. Mit der E-Mail wird darauf hingewiesen, dass ein neuer Fotobeleg-Auftrag in der App eingestellt ist.
Bitte synchronisieren Sie die App vor der Nutzung, um immer die aktuellen Aufträge sichtbar zu machen.
Sofern Sie keine Einwilligung zur automatisierten Nutzung Ihrer E-Mail-Adresse erteilen, sollten Sie im Interesse der zeitnahen Bearbeitung öfter in der App nachschauen, ob ein neuer Auftrag eingestellt wurde. Eine telefonische Information oder Information mit individueller E-Mail kann aufgrund der Bearbeitungsdichte nicht sichergestellt werden.
Die erteilte Einwilligung zur automatisierten Nutzung der E-Mail-Adresse kann von Ihnen jederzeit schriftlich (per E-Mail, Fax oder Brief) widerrufen werden. Ein Widerruf über ANDI ist nicht möglich. Wir bitten um Verständnis, dass es zwischen Eingang Ihres Widerrufs und der Umsetzung/Hinterlegung im Bearbeitungssystem ggf. zu zeitlichen Verzögerungen kommen kann, da diese Eintragung händisch vorgenommen werden muss. Auch wenn die Eingabe des Widerrufs schnellstmöglich erfolgt, ist nicht auszuschließen, dass es zu einer zeitlichen Überschneidung kommt und Sie trotz des Widerrufs noch eine automatisierte Benachrichtigung erhalten.
Sobald der Widerruf im Bearbeitungssystem hinterlegt ist, erfolgt keine automatisierte Nutzung der E-Mail-Adresse mehr. Eine individuelle Kontaktaufnahme durch die Bewilligungsstelle im Rahmen der sonstigen Antragsbearbeitung würde weiterhin erfolgen.
Sofern Sie im Vorjahr Angaben gemacht haben, sind die Felder entsprechend vorbelegt. Bitte prüfen Sie die Angaben und nehmen ggf. Änderungen vor.
In diesen Feldern werden die Daten zu Ihren Bankverbindungen (IBAN) sowie die Angaben zum zuständigen Finanzamt erfasst. Diese Angaben sind Pflichtangaben.
Gegebenenfalls sind die Felder mit den von Ihnen angegebenen Daten aus dem Vorjahr vorbelegt. Bitte überprüfen Sie sorgfältig, ob die Daten weiterhin gültig sind. Sollten sich Änderungen ergeben haben, sind die Angaben entsprechend zu korrigieren.
Zuständiges Finanzamt: In diesem Feld wird das zuständige Veranlagungs- bzw. Festsetzungsfinanzamt sowie die entsprechende Finanzamtsnummer für Ihre Einkommensteuer vorbelegt. Sofern Sie im Vorjahr keinen Antrag gestellt haben, ist dieses Feld verpflichtend auszufüllen. Für die Suche können Sie die ersten Buchstaben Ihres Wohnortes angeben, dann wird Ihnen in einem Drop-down-Feld eine Auswahl an möglichen Finanzämtern angezeigt, aus denen Sie das für Sie zuständige auswählen können. Sollte ein anderes Finanzamt für die Veranlagung bzw. Festsetzung Ihrer Einkommensteuer zuständig sein, ist eine Änderung über ERNI erforderlich.
IBAN: Sowohl nationale wie auch grenzüberschreitende Zahlungen innerhalb des Euro-Zahlungsraums sind im SEPA-Verfahren (Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum) abzuwickeln. Eine Auszahlung ist daher nur mit korrekter IBAN (International Bank Account Number - Internationale Bankkontonummer) möglich. In Deutschland hat jede IBAN 22 Stellen. Die IBAN beginnt immer mit dem Länderkennzeichen (z. B. DE für Deutschland) und der zweistelligen Prüfziffer für die gesamte IBAN, die aufgrund einer genau festgelegten Formel berechnet wird. Es folgen die acht Stellen lange Bankleitzahl und die maximal zehnstellige Kontonummer. Sofern die Kontonummer keine zehn Stellen hat, werden die fehlenden Stellen von vorne mit Nullen aufgefüllt.
Bank: In diesem Feld wird der Name der Bank, an die mit dem Sammelantrag beantragten Beihilfen überwiesen werden sollen, automatisch nach vollständiger Erfassung der IBAN angezeigt.
Ggf. Kontoinhaber: In diesem Feld kann der Name des Kontoinhabers erfasst werden, an den die mit dem Sammelantrag beantragten Beihilfen überwiesen werden sollen, wenn dieser von den obigen Angaben zum Betrieb abweicht. In diesem Fall müssen zwingend Angaben im Bereich 1.2 bzw. 1.3 vorliegen. Ist der Name aus dem Vorjahr vorbelegt, prüfen Sie bitte die Angabe und nehmen ggf. Änderungen vor.
Bitte beachten Sie, dass Zahlungen ausschließlich auf das Bankkonto des Begünstigten oder auf das Bankkonto einer für die Durchführung des Antragsverfahrens bevollmächtigten Person geleistet werden dürfen. Die Bevollmächtigung ist der Behörde nachzuweisen.
Die Erfassung von abweichenden Bankverbindungen ist bereits seit 2022 nicht mehr möglich. Sollte diese Angabe erforderlich sein, wenden Sie sich bitte an die zuständige Bewilligungsstelle der Landwirtschaftskammer.
Steuer-Identifikationsmerkmal:
Jeder Betrieb, der landwirtschaftlich tätig ist und dessen landwirtschaftliche Tätigkeit eine wirtschaftliche Außenwirkung entfaltet, muss die Frage, ob für seinen Betrieb eine wirtschaftliche Tätigkeit gem. § 139 a Abgabenordnung vorliegt zwingend mit "ja" beantworten.
Zur eindeutigen Identifizierung wird jedem wirtschaftlich Tätigen kontinuierlich ab November des Jahres 2024 von den zuständigen Finanzämtern die Wirtschafts-Identifikationsnummer (Wirtschafts-ID) stufenweise ohne Antragstellung zugeteilt. Aufgrund der stufenweisen Zuteilung werden zur Antragstellung 2025 viele Begünstigte noch nicht über eine Wirtschafts-ID verfügen.
Die Identifikationsnummer für natürliche Personen (Steuer-ID), die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (Umsatzsteuer-ID) und die Steuernummer bleiben daher neben der Wirtschafts-ID bestehen. Von allen Begünstigten ist verpflichtend ein Steuer-Identifikationsmerkmal anzugeben.
Zu den Steuer-Identifikationsmerkmalen zählen:
- die Wirtschafts-Identifikationsnummer (Wirtschafts-ID, setzt sich aus den Buchstaben „DE“, neun Ziffern und nach einem Bindestrich aus dem im Antragsjahr 2025 noch einheitlichen Unterscheidungsmerkmal 00001 zusammen (Beispiel: DE123456789-00001).
- die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (anzugeben bei Personengesellschaften oder juristischen Personen, sofern vorhanden),
- die Steuer-Identifikationsnummer (anzugeben bei natürlichen Personen) und
- die Steuernummer (muss bei jedem Betrieb angegeben werden).
Je nach Beantwortung der vorgeschalteten Abfrage nach der wirtschaftlichen Tätigkeit gemäß §139a AO (Abgabenordnung) und der damit in Zusammenhang stehenden beantragte/n Maßnahme/n wird gesteuert, welche Angaben von Ihnen verpflichtend einzutragen sind. So ist bei Betrieben mit der Rechtsform GbR/eGbR/ Eheleute/ sonstige Personengesellschaften bei Vorliegen einer wirtschaftlichen Tätigkeit gemäß § 139a AO und den mit dieser Tätigkeit in einem Zusammenhang stehenden beantragten Maßnahmen ein Steuer-Identifikationsmerkmal zu erfassen. Eine wirtschaftlich tätige GbR hat ihre Wirtschafts-ID, oder wenn nicht vorhanden, ihre Umsatzsteuer-ID, oder wenn nicht vorhanden, ihre Steuernummer anzugeben. Die GbR-Betriebe, denen noch keine Wirtschafts-ID zugeteilt wurde, können weiterhin ihre Umsatzsteuer-ID, oder wenn nicht vorhanden, ihre Steuernummer angeben.
Bei einer GbR (einschließlich eGbR), die nicht wirtschaftlich tätig ist, sind die Steuer-Identifikationsnummern der einzelnen Gesellschafter der GbR unter Punkt 1.2 zu erfassen. Dies ist hier mit einem Haken bei "Angaben zur Steuer-Identifikationsnummer sind über die Gesellschafter erfolgt" zu bestätigen.
Sofern Sie die Steuer-ID bereits im Vorjahr angegeben haben, ist sie in ANDI vorbelegt.
Unternehmens- und Rechtsform des Betriebes
Hier ist angegeben, in welcher Form Sie Ihr Unternehmen betreiben. Die vorliegenden Daten sind entsprechend Ihren Angaben in Ihrem Registriernummernantrag vorbelegt. Eine Änderung dieser Daten ist nur stark eingeschränkt möglich, da eine Änderung ggf. zu einer Neuvergabe einer Registriernummer führen würde. Bitte prüfen Sie die eingetragenen Daten sorgfältig und teilen Sie ggf. erforderliche Korrekturen handschriftlich auf dem Datenbegleitschein mit bzw. nehmen Sie die entsprechende Änderung im ERNI-Portal vor.
Bei Einzelunternehmen bzw. natürlichen Personen ist zusätzlich anzugeben, ob der Betrieb im Haupt- oder Nebenerwerb geführt wird.Rechtsform: Hier wird die für Ihren Betrieb gemeldete Rechtsform angegeben. Sofern als Rechtsform eine Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (GbR) oder Eheleute bzw. eheähnliche Gemeinschaft angegeben wurde, ist von den Gesellschaftern bzw. Mitgliedern durch Unterschrift auf dem Datenbegleitschein in der Tabelle unter Ziffer 1.2 oder auf der Anlage "Zusatzangaben für Gesellschaften bürgerlichen Rechts" (ehemals Anlage 10) persönlich zu erklären, dass sie damit einverstanden sind, dass sie als Gesellschafter/-in der GbR im Falle einer Rückforderung von zu Unrecht gezahlten Prämien und Beihilfen nicht nur im Rahmen der Gesellschaftereinlage, sondern auch mit ihrem Privatvermögen gesamtschuldnerisch zur Haftung herangezogen werden können. Dieses gilt auch im Fall der Auflösung der GbR.
Sofern Sie sich über die BundID oder MUK authentifizieren, reichen Sie die „Zusatzangaben für Gesellschaften bürgerlichen Rechts“ bitte bis spätestens zum 31.05. bei der zuständigen Bewilligungsstelle ein.
Sollte der Betrieb in Form einer eGbR geführt werden, ist die Vertretungsbefugnis nach außen bereits über die Eintragungen im Gesellschaftsregister festgelegt. Der Rechtsverkehr kann sich somit einfach und rechtssicher über die Vertretungsbefugnis informieren.
Als Eheleute bzw. Partner/in in einer eheähnlichen Gemeinschaft haben Sie zu erklären, dass Sie im Falle einer Rückforderung von zu Unrecht gezahlten Prämien und Beihilfen mit Ihrem Privatvermögen gesamtschuldnerisch zur Haftung herangezogen werden können. Dieses gilt auch im Falle der Auflösung der Ehe bzw. eheähnlichen Gemeinschaft. Bitte prüfen Sie die eingetragenen Daten sorgfältig.
Geburts- / Gründungsdatum: Wenn Sie Ihren Antrag als natürliche Person stellen, wird in diesem Feld Ihr Geburtsdatum angegeben. Ansonsten wird hier das Gründungsdatum des Unternehmens angegeben. Bitte prüfen Sie die Angabe. Sofern kein Datum vorbelegt ist oder die Vorbelegung nicht richtig ist, teilen Sie uns das korrekte Datum bitte handschriftlich auf dem Datenbegleitschein mit oder nehmen Sie die entsprechende Änderung im ERNI-Portal vor. Bei der Rechtsform "Eheleute" ist das Datum der Eheschließung in das Feld "Gründungsdatum" einzutragen.
Geburts- / Gründungsort: Wenn Sie Ihren Antrag als natürliche Person stellen, wird in diesem Feld Ihr Geburtsort angegeben. Ansonsten wird hier der Gründungsort des Unternehmens angegeben. Bitte prüfen Sie die Angabe. Sofern kein Ort vorbelegt ist oder die Vorbelegung nicht richtig ist, teilen Sie uns den korrekten Ort bitte handschriftlich auf dem Datenbegleitschein mit oder geben Sie ihn im ERNI-Portal an.
Geschlecht: Ab dem Antragsjahr 2023 ist die Erfassung eines Geschlechts für alle Rechtsformen Pflicht. Dieses Feld ist daher ein Pflichtfeld für alle Begünstigten, d. h. auch wenn Sie Ihren Antrag nicht als natürliche, sondern als juristische Person stellen, ist die Angabe eines Geschlechts erforderlich.
Es ist das Geschlecht der Betriebsinhaberin/ des Betriebsinhabers anzugeben. Bei einer Gruppe natürlicher Personen, einer juristischen Person oder einer Gruppe juristischer Personen ist das Geschlecht der Hauptbetriebsleiterin/ des Hauptbetriebsleiters anzugeben. Gibt es keine natürliche Person, die die Hauptbetriebsleitung innehat, ist das Geschlecht der Mehrheit der Betriebsleiterinnen bzw. Betriebsleiter anzugeben. Gibt es eine solche Mehrheit nicht, ist "keine Prävalenz" auszuwählen.
Sofern Sie Ihren Antrag als natürliche Person stellen, ist das Feld mit den Angaben aus dem Vorjahr vorbelegt. Bitte prüfen Sie die Angabe und nehmen eine Korrektur gegebenenfalls direkt im Programm vor.
Sonstiger Landbewirtschafter (ELER): Sofern Sie nicht Bewirtschafter eines landwirtschaftlichen Betriebes sind und keine Direktzahlungen beantragen bzw. als Naturschutzverband nur Zahlungen für bestimmte flächenbezogene Maßnahmen im Rahmen der 2. Säule (ELER) beantragen, ist hier von Ihnen anzugeben, dass Sie "sonstiger Landbewirtschafter (ELER)" sind.
Zusatzangaben für Samtgemeinden / Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden
Hier ist für Samtgemeinden bzw. Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden anzugeben, wer für die Bewirtschaftung der im Antrag angegebenen Flächen zuständig und damit letztlich antragsberechtigt ist. Zunächst ist eine Versicherung abzugeben, inwieweit die Bewirtschaftung der im Antrag aufgeführten Flächen gemäß dem Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der Zuständigkeit der Samtgemeinde bzw. Mitgliedsgemeinde liegt. Wählen Sie dann aus, ob Sie den Antrag als Samtgemeinde oder als Mitgliedsgemeinde stellen und geben Sie anschließend den Gemeindenamen an.
1.2 Zusatzangaben für Gesellschaften des bürgerlichen Rechts, Eheleute bzw. eheähnliche Gemeinschaften
Hier sind alle Gesellschafter/Mitglieder von Gesellschaften des bürgerlichen Rechts (GbR) oder Ehepartner bzw. Partner einer eheähnlichen Gemeinschaft, die den Betrieb gemeinsam bewirtschaften, anzugeben.
Hinweis: Alle Gesellschafter/ Mitglieder müssen zwingend auf dem Datenbegleitschein unter Ziffer 1.2 in der Tabelle unterschreiben. Alternativ kann eine Anlage "Zusatzangaben für Gesellschaften bürgerlichen Rechts" als Zusatz zum Datenbegleitschein abgegeben werden. Wenn Sie sich über die BundID oder MUK authentifizieren, geben Sie den entsprechenden Vordruck bitte ausgefüllt bis zum 31.05. bei der zuständigen Bewilligungsstelle ab. Die Gesellschafter bzw. Mitglieder erklären mit ihrer Unterschrift, dass sie im Falle einer Rückforderung der gewährten Beihilfen bzw. Prämien nicht nur im Rahmen der Gesellschaftereinlage haften, sondern auch persönlich mit dem Privatvermögen. Dieses gilt auch für den Fall einer Auflösung der Gesellschaft bzw. des Unternehmens. Eheleute bzw. Partner in eheähnlicher Gemeinschaft haben zu erklären, dass jeder Partner auch im Falle einer Trennung persönlich mit dem Privatvermögen haftet.
Informationen zu den Gesellschaftern bzw. Mitgliedern, die aus dem vorherigen Antragsjahr vorliegen, werden Ihnen in der Tabelle unter Ziffer 1.2 vorgegeben. Prüfen Sie die Angaben sorgfältig und ändern die Angaben gegebenenfalls bzw. fügen fehlende Angaben hinzu. Bestätigen Sie die weiterhin verantwortlichen Mitglieder mit dem Status "gültig". Nicht mehr verantwortliche Mitglieder kennzeichnen Sie mit dem Status "ungültig". Markieren Sie dazu die entsprechende Zeile in der Tabelle mit einem einfachen Klick mit der linken Maustaste und wählen dann den entsprechenden Status aus. Die Daten der Mitglieder (Name, Anschrift usw.) können bis auf Geburtsort und Geburtsdatum nicht im Programm geändert werden. Sofern diese Daten nicht vollständig bzw. nicht aktuell sind, sind sie auf dem Datenbegleitschein unter Ziffer 1.2 zu ändern, bzw. bei Authentifizierung über die BundID oder MUK direkt im ERNI-Portal.
Neue Mitglieder können über die grüne Schaltfläche "+hinzufügen" erfasst werden. Die Funktion "löschen" ist nur für neu hinzugefügte Mitglieder nutzbar. Soll ein neu hinzugefügtes Mitglied wieder entfernt werden, markieren Sie die entsprechende Zeile in der Tabelle per Mausklick und klicken die Schaltfläche "löschen" an.
1.3 Vollmacht/Vertretungsberechtigung
Hier ist zunächst anzugeben, ob Sie für die Antragstellung eine Vollmacht erteilt haben bzw. eine Vollmacht erteilen wollen oder ob eine gesetzliche Vertretungsberechtigung vorliegt.
Sofern Sie im Antragsverfahren des Vorjahres Dritten eine Bevollmächtigung bzw. eine Vertretungsberechtigung erteilt haben, sind diese im Antrag für das aktuelle Jahr vorbelegt. Bitte prüfen Sie die vorgegebenen Angaben sorgfältig und bestätigen bestehende Vollmachten mit dem Status "gültig". Sofern die angegebenen Adressdaten nicht vollständig oder aktuell sind, sind diese in den entsprechenden Feldern im Programm zu korrigieren.
Nicht mehr bestehende Vollmachten sind mit dem Status "ungültig" zu kennzeichnen.
Neue Bevollmächtigte oder Vertretungsberechtigte können über die grüne Schaltfläche "+hinzufügen" erfasst werden. Entsprechende neue Vollmachten für diese Personen sind zusammen mit dem Datenbegleitschein unter Verwendung des dafür vorgesehenen Vordrucks einzureichen bzw. bei Authentifizierung über die BundID oder MUK bis zum 31.05. der zuständigen Bewilligungsstelle vorzulegen.
Die Funktion "Löschen" ist nur für neu erfasste Vollmachten möglich. Falls die Angaben zu einer neu erfassten Vollmacht nicht korrekt sind, markieren Sie die entsprechende Zeile in der Tabelle und löschen die Vollmacht mit einem Klick auf die Schaltfläche "löschen".
Name / Bezeichnung: Hier wird der Nachname der/des Bevollmächtigten / Vertretungsberechtigten angegeben. Sollte es sich um eine nicht natürliche Person handeln, wird die Bezeichnung ebenfalls in dieses Feld eingetragen.
Vorname: Hier wird der Vorname der/des Bevollmächtigten / Vertretungsberechtigten angegeben. Sollte es sich um eine nicht natürliche Person handeln, bleibt dieses Feld frei.
E-Mail: Mit der neuen Förderperiode werden verpflichtend betriebsbezogene Angaben zu den Kontaktdaten eines Bevollmächtigten („…im Falle einer Bevollmächtigung den Namen und die Anschrift sowie die E-Mail-Adresse des Bevollmächtigten“) gefordert. Auch von Bevollmächtigten ist daher verpflichtend eine gültige E-Mailadresse zu erfassen.
Weiterhin ist die Adresse der/des Bevollmächtigten anzugeben.
Art der Vollmacht: Hier können Sie zwischen einer befristeten, einer unbefristeten und einer gesetzlichen Vollmacht entscheiden.
Vollmacht gültig ab: Sollten Sie eine Vollmacht erteilen, müssen Sie das Datum angeben, ab wann diese gültig ist. Dieses Datum darf nicht nach dem Datum "Vollmacht gültig bis" liegen.
Vollmacht gültig bis: Sollten Sie eine befristete Vollmacht erteilen, müssen Sie das Datum angeben, bis wann diese gültig ist. Bei einer unbefristeten Vollmacht ist hier keine Datumsangabe erforderlich.
Vollmacht liegt vor: Dieses Feld muss gekennzeichnet werden, wenn der Vordruck zur Erteilung einer Vollmacht der Dienststelle der Landwirtschaftskammer bereits vorliegt.
Vollmacht liegt bei: Wollen Sie eine neue Vollmacht erteilen, muss dieses Feld gekennzeichnet werden. Die Vollmacht ist dem Datenbegleitschein beizufügen. Einen Vordruck zur Erteilung einer Vollmacht finden Sie unter "Dokumente und Formulare". Bei Authentifizierung über die BundID oder MUK ist der entsprechende Vordruck bis zum 31.05. bei der zuständigen Bewilligungsstelle einzureichen.
1.4 Angaben zum aktiven Landwirt/Betriebsinhaber
Voraussetzung für die Gewährung der Einkommensstützungen ist seit dem Antragsjahr 2023 der Nachweis der Eigenschaft "aktiver Betriebsinhaber". Ein aktiver Betriebsinhaber ist ein Betriebsinhaber, der oder dessen Unternehmen nach den Vorschriften des SGB VII (Siebtes Buch Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Unfallversicherung) Mitglied in der landwirtschaftlichen Unfallversicherung ist. Hierbei handelt es sich für einen Großteil der Begünstigten um die verpflichtende Unfallversicherung bei der SVLFG (Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau). Ausnahmen gelten, wenn die Begünstigten bei der Unfallversicherung Bund und Bahn oder einer Unfallversicherung im Landesbereich pflichtversichert sind. Diese Versicherungen erfüllen die Voraussetzungen für das Vorliegen der Eigenschaft als aktiver Betriebsinhaber ebenfalls. Die BG Verkehr erfüllt die Voraussetzungen zum Vorliegen der Eigenschaft "aktiver Betriebsinhaber" nicht.
Ein geeigneter Nachweis ist der Beleg über die Beitragszahlung (z.B. Kontoauszug) oder, soweit dieser noch nicht vorliegt, ein Beleg (Bescheid) über den Beginn der Zuständigkeit der jeweiligen Unfallversicherung.
Mit der Antragstellung, spätestens jedoch bis zum 30.09. des Antragsjahres muss von allen Begünstigten ein geeigneter Nachweis über die Mitgliedschaft in einer der genannten Versicherungen vorgelegt werden, sofern dieser Nachweis der zuständigen Behörde nicht bereits vorliegt. Der Termin 30.09. ist hierbei eine Ausschlussfrist. Werden die Unterlagen nicht bis zu diesem Termin vorgelegt, führt dies grundsätzlich zur Ablehnung des Antrags. Auch bei Nachreichen der Unterlagen müssen die Voraussetzungen für das Vorliegen der Eigenschaft "aktiver Betriebsinhaber" bereits zum Zeitpunkt der Antragstellung vorgelegen haben.
Die Voraussetzungen für das Vorliegen der Eigenschaft "aktiver Betriebsinhaber" sind auch erfüllt, wenn der Betriebsleiter oder dessen Unternehmen ohne die Anwendbarkeit des Titels II der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 Mitglied in einer der unter 1.4.2 genannten Unfallversicherungen wäre. Dies ist der Fall, wenn eine Mitgliedschaft bei einer entsprechenden Pflichtversicherung im Ausland besteht. In diesem Fall ist anzugeben, in welchem Staat die Versicherungspflicht besteht und eine entsprechende Bescheinigung vorzulegen (z. B. A1-Bescheinigung). Mit der Antragstellung, spätestens jedoch bis zum 30.09. des Antragsjahres muss ein geeigneter gültiger Nachweis über das Vorliegen der Voraussetzungen nach Verordnung (EG) Nr. 883/2004 vorgelegt werden, sofern dieser Nachweis der zuständigen Behörde nicht bereits vorliegt.
Informationen zur A1-bescheinigung finden Sie hier: https://www.dvka.de/de/arbeitgeber_arbeitnehmer/antraege_finden/gewoehnliche_erwerbstaetigkeit_mitgliedstaaten/f_rechtsvorschriften_zustaendige_stellen/rechtsvorschriften_zustaendige_stellen.html
Die Eigenschaft als aktiver Betriebsinhaber ist auch gegeben, wenn der Betriebsinhaber für das Vorjahr zum dem Jahr, für das ein Antrag auf Direktzahlungen gestellt wird, vor Anwendung von Sanktionen keinen Anspruch auf Direktzahlungen von über 5.000 Euro hatte. In diesem Fall kann der Nachweis durch den letztjährigen Bewilligungsbescheid erfolgen, sofern er der zuständigen Behörde nicht vorliegt (z. B. bei Umzug aus einem anderen Bundesland). Sollten Sie unter diese Gruppe fallen und bereits im Vorjahr in Niedersachsen, Bremen oder Hamburg einen ANDI-Antrag gestellt haben, liegen die entsprechenden Unterlagen vor und Sie müssen keine Unterlagen hierzu einreichen.
Des Weiteren liegen die Voraussetzungen für die Eigenschaft als aktiver Betriebsinhaber vor, wenn für das Vorjahr zu dem Jahr, für das ein Antrag auf Direktzahlungen gestellt wird, keine Direktzahlungen beantragt wurden und der Anspruch für das aktuelle Antragsjahr nicht größer als 5.000 Euro ist. Der entsprechende Betrag ergibt sich durch die Multiplikation des Betrags von 225 Euro mit der Hektarzahl der förderfähigen Fläche im Jahr der Antragstellung. Eine entsprechende Berechnung ist mit Antragstellung vorzulegen.
Aktiver Betriebsinhaber ist auch der Betriebsinhaber, bei dem keine der oben genannte Varianten zutrifft, der aber mindestens eine zusätzliche sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitskraft in seinem landwirtschaftlichen Betrieb beschäftigt. Sogenannte Minijobs finden hier keine Berücksichtigung. Unterlagen, die das Vorliegen dieser Voraussetzung für das jeweilige Antragsjahr belegen, wie z.B. Arbeitsvertrag und Sozialversicherungsnachweis, sind mit jeder Antragstellung erneut vorzulegen. Die Vorlage muss spätestens bis zum 30.09. des jeweiligen Antragsjahres erfolgen.
1.5 Angaben zur Zugehörigkeit zu einer Unternehmensgruppe
Unter diesem Punkt ist anzugeben, ob Sie bzw. ihr Betrieb einer Gruppe nach Artikel 2 Nummer 11 der Richtlinie 2013/34/EU (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0034&from=fi) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates (ABl. L 182 vom 29.06.2013, S. 19), die zuletzt durch die Richtlinie (EU) 2021/2101 (ABl. L 429 vom 01.12.2021, S. 1) geändert worden ist, angehören/angehört. Eine Gruppe umfasst ein Mutterunternehmen und alle Tochterunternehmen.
Sollten Sie diese Abfrage mit "ja" beantworten, sind im Folgenden alle Mutter- und Tochterunternehmen zu erfassen, unabhängig davon, ob diese einen landwirtschaftlichen Bezug haben. Es sind hier Angaben zu allen Mutter- und Tochterunternehmen zu machen, Angaben zu Schwesterunternehmen sind nicht erforderlich. Die Rechtsform der jeweiligen Unternehmen ist unerheblich, daher müssen auch Einzelunternehmen erfasst werden.
Für jedes Unternehmen der Gruppe ist anzugeben, ob es sich um das Mutter- oder ein Tochterunternehmen handelt. Zu dem jeweiligen Unternehmen sind neben dem Namen und der vollständigen Adresse auch die die Unternehmensart sowie die Wirtschafts-Identifikationsnummer anzugeben. Wenn bisher keine Wirtschafts-Identifikationsnummer vergeben wurde, ist die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer anzugeben oder, wenn auch diese bisher nicht vergeben wurde, die Steuernummer anzugeben. Zusätzlich sind Angaben zur Gültigkeit des jeweiligen Unternehmens zu machen.
Als Orientierung, wann es sich um verbundene Unternehmen handelt, verweisen wir auf Artikel 3 des Anhangs 1 der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 06. Mai 2003. Danach sind verbundene Unternehmen solche, die zueinander in einer der folgenden Beziehungen stehen (ABl. der EU L 124/36 vom 20.05.2003):
− ein Unternehmen hält die Mehrheit der Stimmrechte der Aktionäre oder Gesellschafter eines anderen Unternehmens;
− ein Unternehmen ist berechtigt, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsgremiums eines anderen Unternehmens zu bestellen oder abzuberufen;
− ein Unternehmen ist gemäß einem mit einem anderen Unternehmen abgeschlossenen Vertrag oder aufgrund einer Klausel in dessen Satzung berechtigt, einen beherrschenden Einfluss auf dieses Unternehmen auszuüben;
− ein Unternehmen, das Aktionär oder Gesellschafter eines anderen Unternehmens ist, übt gemäß einer mit anderen Aktionären oder Gesellschaftern dieses anderen Unternehmens getroffenen Vereinbarung die alleinige Kontrolle über die Mehrheit der Stimmrechte von dessen Aktionären oder Gesellschaftern aus.
Die genannten Voraussetzungen für den Status des verbundenen Unternehmens gelten in gleicher Weise bei der Umkehrung der genannten Beziehungen zwischen den betrachteten Unternehmen als erfüllt. Unternehmen, die durch ein oder mehrere andere Unternehmen untereinander in einer der o. g. Beziehungen stehen, gelten ebenfalls als verbunden.
Zwei oder mehr Unternehmen sind miteinander verbunden, wenn sie eine der folgenden Beziehungen eingehen:
- Ein Unternehmen ist verpflichtet, einen konsolidierten Jahresabschluss zu erstellen;
- Ein Unternehmen hält die Mehrheit der Stimmrechte der Aktionäre oder Gesellschafter eines anderen Unternehmens; (Hinweise: Mutter-Tochter-Unternehmen, zu recherchieren im Handels -, Genossenschaftsregister);
- ein Unternehmen ist berechtigt, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsgremiums eines anderen Unternehmens zu bestellen oder abzuberufen; (Hinweis: Gesellschaftsvertrag oder Gesellschaftervereinbarung);
- ein Unternehmen kann gemäß einem zwischen den Unternehmen geschlossenen Vertrag (z.B. Beherrschungsvertrag) oder aufgrund einer Klausel in der Satzung eines der Unternehmen einen beherrschenden Einfluss auf das andere Unternehmen ausüben; (Hinweise: Handels-, Genossenschaftsregister, evtl. Prüfung der Gesellschaftsverträge);
- ein Unternehmen kann gemäß einer Vereinbarung die alleinige Kontrolle über die Mehrheit der Stimmrechte der Aktionäre oder Gesellschafter in einem anderen Unternehmen ausüben. (Hinweis: Handelsregister).
- Unternehmen, die durch eine natürliche Person oder eine gemeinsam handelnde Gruppe natürlicher Personen miteinander in einer der genannten Beziehungen stehen, gelten gleichermaßen als verbundene Unternehmen, sofern diese Unternehmen ganz oder teilweise in demselben Markt oder in benachbarten Märkten tätig sind. Auf die örtliche Nähe kommt es hierbei grundsätzlich nicht an. Nicht ausreichend ist es jedoch, dass eine natürliche Person lediglich an mehreren Unternehmen beteiligt ist. Hinzukommen muss immer die Beherrschung, in der Praxis oftmals das Halten der Mehrheit der Unternehmensanteile bei dieser natürlichen Person oder Personengruppe. (vgl. Urteil des EuGH vom 27.02.2014 – C-110/13).
Das Merkmal der gemeinsam handelnden Gruppe natürlicher Personen ist insbesondere bei Gruppen mit „familiärer Verbindung “ anzunehmen. Nach dem Benutzerleitfaden der KOM gelten familiäre Verbindungen als ausreichend für die Schlussfolgerung, dass natürliche Personen gemeinsam handeln. Hierunter fallen ausgehend vom Begünstigten insbesondere Eheleute, eingetragene Partnerschaften, Kinder, Eltern und Geschwister. Weiter entfernte Familienangehörige sowie Stiefkinder und Lebensgefährten werden nicht dazu gezählt. Die Stimmanteile können dabei unterschiedlich verteilt sein. Entscheidend ist, dass die Gruppe insgesamt einen beherrschenden Einfluss auf die zu betrachtenden Unternehmen hat. In diesem Fall handelt es sich immer um verbundene Unternehmen. Anders ist es, wenn die Familienmitglieder zwar beteiligt sind, aber insgesamt keinen beherrschenden Einfluss ausüben können.
Benachbarte Märkte oder eng miteinander verbundene benachbarte Märkte sind Märkte, deren jeweilige Waren oder Dienstleistungen einander ergänzen oder deren Waren zu einer Produktpalette gehören, die in der Regel von der gleichen Kundengruppe für dieselbe Endverwendung gekauft werden. Vertikale Beziehungen in einer Wertschöpfungskette sollten ebenfalls berücksichtigt werden. Jeder Fall muss daher unter Berücksichtigung der besonderen Umstände und des spezifischen Kontexts geprüft werden.
Beispiele für verbundene Unternehmen bei Beteiligung von juristischen Personen bzw. Personengesellschaften
Grundsatz: Die Bewilligungsstelle darf auf die im Antrag gemachten Angaben vertrauen und muss diese nur bei Anhaltspunkten für Unvollständigkeit oder Fehlerhaftigkeit prüfen. Hierzu sind ggf. Handelsregisterauszüge mit Gesellschafterlisten und Organigramme einzuholen.
Beispiel 1: Ein Unternehmen hält 100 % der Anteile eines Tochterunternehmens.
Beispiel 2: Ein Unternehmen hält die Mehrheit der Anteile (also über 50 %) eines Tochterunternehmens oder kann anderweitig einen beherrschenden Einfluss ausüben.
Beispiel 3: Die verbundenen Unternehmen A, B und C halten jeweils 20 % der Geschäftsanteile bei dem Unternehmen D, so dass sie insgesamt mit 60 % der Anteile beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen D haben. -> Verbund aller Unternehmen (Hinweis: Auf das Prüfungskriterium gleicher oder benachbarter Markt kommt es hier nicht an.)
Beispiel 4: Ein Unternehmen hält jeweils die Mehrheit der Anteile, also über 50 %, an zwei Tochterunternehmen A und B (jeweils beherrschender Einfluss). -> Verbund aller Unternehmen
Beispiel 5: Ein Unternehmen A (Besitzgesellschaft) vermietet das gesamte Betriebsgebäude an das Unternehmen B (Betriebsgesellschaft). Die beherrschenden Gesellschafter von A und B sind die gleichen Personen (Verbund beider Unternehmen). Es handelt sich zwar um verschiedene Märkte, das Betriebsgebäude ist jedoch eine wesentliche Betriebsgrundlage und die Vermietung ist alleiniger Unternehmensgegenstand der Besitzgesellschaft; zudem sind die Gesellschafter identisch.
Beispiel 6: Die X-Holding AG ist an der Y-GmbH und der Z-GmbH beteiligt. Die X-Holding AG erstellt einen konsolidierten Jahresabschluss, in den beide GmbHs aufgenommen sind. Es handelt sich dann um verbundene Unternehmen, da sie einen gemeinsamen Konzernabschluss erstellen müssen.
Ergänzende Angaben zu Betriebssitzland, Belegenheitsland und Betriebsstätten
In diesem Bereich sind Angaben zur Lage des Betriebssitzes, zur Lage der bewirtschafteten Flächen, zu weiteren Betriebsstätten und zur etwaigen Beantragung von Zahlungen in anderen Bundesländern bzw. weiteren EU-Mitgliedstaaten zu machen.
2.1 Hauptsitz des Betriebes in Niedersachsen / Bremen / Hamburg
Markieren Sie unter Ziffer 2.1 im dafür vorgesehenen Feld, wenn sich der Hauptsitz Ihres Betriebes (Betriebssitzland) innerhalb von Niedersachsen, Bremen oder Hamburg befindet und Sie Direktzahlungen in Niedersachsen, Bremen und/oder Hamburg beantragen. In diesem Fall erfolgt die Auszahlung der Förderung über das Bundesland Niedersachsen.
Ist dies der Fall, so müssen Sie im Folgenden eine der Ziffern 2.1.1 bis 2.1.3 angeben.
Ziffer 2.1.1 ist zu wählen, wenn sich Ihr Betrieb einschließlich aller bewirtschafteten Flächen ausschließlich in Niedersachsen/Bremen/Hamburg befindet.
Bitte beachten: Ziffer 2.1.1 ist auch zu wählen, wenn Ihr Hauptbetriebssitz nicht in Niedersachsen / Bremen / Hamburg liegt, Sie aber mit Ihrem Betriebssitzland eine Zuständigkeitsänderung schriftlich vereinbart haben. In diesem Fall bewirtschaften Sie in Ihrem Betriebssitzland keine Flächen, sondern ausschließlich Flächen in Niedersachsen / Bremen / Hamburg und Sie haben von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, ihren Betriebssitz im Sinne des § 2 Absatz 3 der GAPInVeKoS-Verordnung an den Ort der Betriebsstätte, also nach Niedersachsen, Bremen oder Hamburg zu verlegen. Allerdings ist diese Verlegung nur möglich, wenn ihr Bundesland dem zugestimmt hat. Verbunden mit diesem Wechsel der Zuständigkeit stellen Sie Ihren gesamten Sammelantrag Agrarförderung in Niedersachsen / Bremen / Hamburg unter der Ihnen erteilten niedersächsischen Registriernummer und werden auch die Förderung aus Niedersachsen erhalten.
Ziffer 2.1.2 ist zu wählen, wenn sich Ihr Betriebssitz in Niedersachsen / Bremen / Hamburg befindet, die bewirtschafteten Flächen sich jedoch nicht vollständig in Niedersachsen / Bremen / Hamburg, sondern teilweise auch in einem anderen Bundesland oder in mehreren anderen Bundesländern befinden. Die niedersächsischen / bremer / hamburger Flächen können Sie über ANDI 2024 beantragen. Die in anderen Bundesländern bewirtschafteten Flächen müssen über die Antragssoftware der jeweiligen Bundesländer gesondert beantragt werden. Informationen hierzu finden Sie im Internet unter www.zi-daten.de/gsaa-adress.html.
Ziffer 2.1.3 ist zu wählen, wenn sich Ihr Betriebssitz in Niedersachsen / Bremen / Hamburg befindet, keine Ihrer Flächen in Niedersachsen / Bremen / Hamburg liegen und alle bewirtschafteten Flächen sich in einem oder mehreren weiteren Bundesländern befinden. Die bewirtschafteten Flächen in den anderen Bundesländern müssen über die Antragssoftware der jeweiligen Bundesländer gesondert beantragt werden. Informationen hierzu finden Sie im Internet unter www.zi-daten.de/gsaa-adress.html.
Wenn Sie zusätzlich zu Ihren in Niedersachsen, Bremen bzw. Hamburg befindlichen Flächen weitere Flächen in anderen Bundesländern bewirtschaften oder sich Ihre Flächen ausschließlich in Bundesländern außerhalb von Niedersachsen, Bremen bzw. Hamburg befinden, sind die betroffenen Bundesländer in der Tabelle "Auswahl der Bundesländer zu 2.1.2 oder 2.1.3" anzugeben. Wählen Sie dazu aus der "Liste der Bundesländer" die Bundesländer aus, in denen sich Ihre Flächen befinden und fügen Sie diese Ihrer Auswahlliste hinzu. Die Auswahl der Bundesländer kann durch einen Doppelklick mit der linken Maustaste auf das betreffende Bundesland erfolgen. Alternativ können Sie ein Bundesland durch einen einfachen Klick mit der linken Maustaste markieren und dann mit einem Klick auf die grüne Schaltfläche ">" Ihrer Auswahl hinzufügen. Es ist auch möglich, mehrere Bundesländer gleichzeitig zu markieren. Halten Sie hierzu die Taste "Strg" gedrückt und markieren Sie die betreffenden Bundesländer jeweils durch einen einfachen Klick mit der linken Maustaste. Durch einen Klick mit der linken Maustaste auf die grüne Schaltfläche ">" fügen Sie alle ausgewählten Bundesländer Ihrer Auswahl hinzu.
Das Entfernen von Bundesländern aus Ihrer Auswahl funktioniert entsprechend umgekehrt zu den aufgeführten Möglichkeiten.
2.2 Hauptsitz des Betriebes außerhalb von Niedersachsen / Bremen / Hamburg
Wenn sich der Hauptsitz Ihres Betriebes außerhalb von Niedersachsen, Bremen oder Hamburg befindet, Sie die Direktzahlungen aus einem anderen Bundesland erhalten und Sie in Niedersachsen / Bremen / Hamburg nur Flächen bewirtschaften, markieren Sie bitte Ziffer 2.2 im dafür vorgesehenen Feld. Niedersachsen / Bremen / Hamburg sind somit die Belegenheitsländer der Flächen. Im Folgenden sind Angaben zur Lage der Flächen und zur Beantragung der Direktzahlungen zu machen.
Wählen Sie dazu die zutreffende Konstellation unter den Ziffern 2.2.1 bis 2.2.4 aus:
Ziffer 2.2.1 ist zu wählen, wenn Sie zusätzlich zu den in Ihrem Betriebssitzland bewirtschafteten Flächen auch Flächen in Niedersachsen, Bremen oder Hamburg für Direktzahlungen anmelden möchten bzw. wenn Sie Flächen in Niedersachsen / Bremen / Hamburg und gegebenenfalls einem oder mehreren anderen Belegenheitsländern bewirtschaften, aber nicht in Ihrem Betriebssitzland. Die Antragstellung ist mit der außerniedersächsischen Registriernummer möglich.
Ziffer 2.2.2 ist zu auszuwählen, wenn Sie zusätzlich zu den in Ihrem Betriebssitzland bewirtschafteten Flächen auch Flächen in Niedersachsen, Bremen oder Hamburg für Direktzahlung und eine Förderung im Rahmen der niedersächsischen / Bremer / Hamburger Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen beantragen möchten. In diesem Fall ist eine Antragstellung ausschließlich mit einer niedersächsischen Registriernummer möglich.
Ziffer 2.2.3 ist zu wählen, wenn Sie alle Ihre Flächen ausschließlich in Niedersachsen bewirtschaften, der Hauptsitz Ihres Betriebes in einem anderen Bundesland liegt, sie dort einen Sammelantrag auf Agrarförderung gestellt haben und sie weiterhin Ihre Direktzahlungen aus Ihrem Betriebssitzland haben möchten. In diesem Fall können Sie weiterhin über Ihre außerniedersächsische Registriernummer (Betriebsnummer) in Niedersachsen Ihre Flächen beantragen.
Sollten Sie den Wunsch haben, zukünftig nur noch einen Sammelantrag auf Direktzahlungen zu stellen, ist dieses möglich, sofern sie auch in folgenden Jahren ausschließlich alle Ihre Flächen in Niedersachsen/Bremen/Hamburg bewirtschaften werden. Dann ist folgender Weg zu wählen: Sie stellen in Ihrem Betriebssitzland einen Antrag auf Übernahme durch Niedersachsen im Sinne des § 2 Absatz 3 der GAPInVeKoS-Verordnung. Ihr Betriebssitzland wendet sich dann an Niedersachsen mit der Bitte um Übernahmebestätigung Ihres Betriebes. Parallel dazu müssen Sie dann in Niedersachsen eine niedersächsische Registriernummer beantragen. Sobald dieses erfolgt ist, können Sie zukünftig immer Ihren Sammelantrag auf Agrarförderung ausschließlich in Niedersachsen mit der niedersächsischen Registriernummer beantragen und können dann die Ziffer 2.1.1 des Sammelantrages anhaken. Sie werden dann alle Direktzahlungen aus Niedersachsen erhalten und müssen nur noch einen Antrag stellen.
Ziffer 2.2.4 ist auszuwählen, wenn sich der Hauptsitz Ihres Betriebes außerhalb von Deutschland befindet und Sie ausschließlich Direktzahlungen in Niedersachsen / Bremen / Hamburg beantragen. Sämtliche von Ihnen bewirtschaftete Flächen befinden sich innerhalb von Niedersachsen / Bremen / Hamburg.
2.3 Betriebsleiter außerhalb von Deutschland
Hier ist anzugeben, ob Sie in einem anderen EU-Mitgliedstaat in Betriebsleiterfunktion landwirtschaftlich tätig sind oder waren. Ist dies der Fall, so sind der Name des entsprechenden Mitgliedstaates sowie die dortige Registriernummer in den dafür vorgesehenen Feldern anzugeben. Diese Informationen sind insbesondere im Rahmen der Junglandwirte-Einkommensstützung von Bedeutung.
Sind Ihnen mehrere Registriernummern zugeordnet und bzw. oder bewirtschaften Sie mehrere Betriebsstätten, werden hier die vorliegenden Daten zu Ihren weiteren Registriernummern bzw. zu Ihren Betriebsstätten angezeigt.
Geben Sie zunächst an, ob Sie weitere Registriernummern / Betriebsstätten besitzen. Anschließend ist anzugeben, ob die ausgewiesenen Daten noch aktuell und vollständig sind. Bestätigen Sie bestehende weitere Registriernummern / Betriebsstätten mit dem Status "gültig". Nicht mehr bestehende weitere Registriernummern/ Betriebsstätten sind mit dem Status "ungültig" zu kennzeichnen. Markieren Sie dazu die entsprechende Zeile in der Tabelle mit einem einfachen Klick mit der linken Maustaste und wählen dann den entsprechenden Status aus. Ergänzen Sie das Stilllegungsdatum bitte in dem dafür vorgesehenen Feld in ANDI. Eine Bearbeitung der ausgewiesenen Daten ist an dieser Stelle im Programm nicht möglich. Sofern die ausgegebenen Daten nicht korrekt oder nicht vollständig sind, so sind diese Änderungen bzw. Ergänzungen ebenfalls auf dem Datenbegleitschein zu vermerken. Sofern Sie die Authentifizierung über die BundID oder MUK nutzen, teilen Sie diese Daten bitte der zuständigen Bewilligungsstelle mit. Wenn Sie Korrekturen aufgrund von betrieblichen Änderungen vornehmen, ist dieses der zuständigen Dienststelle der Landwirtschaftskammer unverzüglich gesondert auf dem Vordruck zur Registriernummernvergabe mitzuteilen. Die gilt auch im Fall einer Authentifizierung über die BundID oder MUK.
Hinweis: Haben Sie einen Betrieb im Rahmen der Generationsfolge oder durch sonstige Betriebsübergabe übernommen, ist dies der zuständigen Dienststelle der Landwirtschaftskammer unverzüglich in schriftlicher Form mitzuteilen. Liegt ein solcher Fall bei Ihnen seit der letzten Antragstellung vor und ist die Betriebsübergabe von Ihnen noch nicht angezeigt worden, so muss dies unverzüglich nachgeholt werden.
Betriebe, die an Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen teilnehmen, müssen zusätzlich auch die Übergabe / Übernahme der Verpflichtung aus den Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen angeben und zusätzlich die Anlage 7a (es ist zwingend die aktuelle Version 2025 zu verwenden) per Original oder als Fax einreichen (siehe auch Ziffer 7.3 des Sammelantrags).
Diese Angaben sind nicht erforderlich für Betriebe mit Betriebssitz außerhalb von Niedersachsen / Bremen / Hamburg, die in Niedersachsen / Bremen / Hamburg nur Direktzahlungen melden.
3.1 Einkommensgrundstützung für Nachhaltigkeit
Hier beantragen Sie die Auszahlung der Einkommensgrundstützung für Nachhaltigkeit. Es ist zwingend anzugeben, ob Sie die Auszahlung der Einkommensgrundstützung beantragen.
Die Einkommensgrundstützung für Nachhaltigkeit ersetzt die Basisprämienregelung aus der vorherigen Förderperiode. Die bisherigen zu aktivierenden Zahlungsansprüche gibt es nicht mehr. Der Betriebsinhaber erhält jährlich auf Antrag bei Vorliegen der Fördervoraussetzungen eine Zahlung, die auf Grundlage der von ihm im Sammelantrag angemeldeten Flächen berechnet wird, die alle Voraussetzungen einer förderfähigen Fläche erfüllen. Die Einkommensgrundstützung wird in bundeseinheitlich gleicher Höhe je Hektar förderfähiger Fläche gewährt.
3.2 Ergänzende Umverteilungseinkommensstützung für Nachhaltigkeit
Die ergänzende Umverteilungseinkommensstützung für Nachhaltigkeit ersetzt die bisherige Umverteilungsprämie. Sie wird als Betrag je Hektar gewährt. Für die ersten 40 Hektar (Gruppe 1) wird ein höherer Betrag gewährt als für die nächsten 20 Hektar (Gruppe 2). Der Betrag für die Zahlung der Gruppe 2 beträgt 60 Prozent des Betrages, der für die Gruppe 1 gewährt wird.
Keine Umverteilungseinkommensstützung wird gewährt, wenn der Betriebsinhaber seinen Betrieb nach dem 1. Juni 2018 nachweislich zu dem Zweck aufgespalten hat, um in den Genuss höherer Zahlungen der Umverteilungseinkommensstützung zu kommen. Dies gilt auch für eine Zahlung an einen Betriebsinhaber, dessen Betrieb aus einer solchen Aufspaltung hervorgegangen ist.
3.3 Ergänzende Einkommensstützung für Junglandwirte (Junglandwirte-Einkommensstützung)
Junglandwirt ist eine natürliche Person, die sich erstmals in einem landwirtschaftlichen Betrieb als Betriebsleiter niederlässt, im Jahr der Niederlassung nicht älter als 40 Jahre ist und über eine bestimmte landwirtschaftliche Qualifikation verfügt. „Nicht älter als 40 Jahre“ bedeutet, dass der Junglandwirt in dem Jahr der erstmaligen Niederlassung noch nicht sein 41. Lebensjahr vollenden darf.
Ein Betriebsinhaber, der keine natürliche Person ist, sondern eine juristische Person oder eine Personengesellschaft, ist Junglandwirt, wenn folgendes erfüllt ist:
Eine natürliche Person kontrolliert – allein oder gemeinschaftlich – den Betriebsinhaber erstmals wirksam und langfristig in Bezug auf die Entscheidungen zur Betriebsführung, zur Verwendung von Gewinnen und zu finanziellen Risiken (also im Innen- und im Außenverhältnis).
Diese natürliche Person ist im Jahr der Aufnahme der Kontrolle nicht älter als 40 Jahre und hat sich zuvor nicht in einem landwirtschaftlichen Betrieb als Betriebsleiter niedergelassen. Ferner muss diese natürliche Person über eine bestimmte Qualifikation zur Antragstellung verfügen. Diese natürliche Person wird im Folgenden als "maßgebliche Person" bezeichnet.
Die Entscheidungen zur Betriebsführung trifft in der Regel die Geschäftsführung, sodass, unabhängig von der Rechtsform, die maßgebliche Person immer (Mit-) Geschäftsführer oder Vorstand sein muss. Da je nach Rechtsform des Betriebsinhabers teilweise Vertragsfreiheit herrscht, muss in jedem Einzelfall durch Vorlage geeigneter Belege (z. B. Handelsregisterauszug, Gesellschaftsvertrag) nachgewiesen werden, dass diese Person die alleinige Kontrolle oder die gemeinschaftliche Kontrolle ausübt.
Die Junglandwirte-Einkommensstützung wird maximal für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Jahr der erstmaligen Beantragung gewährt. Die erstmalige Beantragung muss spätestens für das fünfte Jahr nach der Niederlassung erfolgen. Für die Junglandwirte-Einkommensstützung kann eine natürliche Person nicht mehr als einmal berücksichtigt werden. Das gilt auch für natürliche Personen, die bei Betriebsinhabern, die keine natürliche Person sind, zur Erfüllung der Junglandwirteeigenschaft berücksichtigt werden. Die Zahlung muss jährlich beantragt werden. Die Junglandwirte-Einkommensstützung wird für maximal 120 Hektar gewährt.
Eine weitere Voraussetzung für den Junglandwirt oder die maßgebliche Person bei anderen Betriebsinhabern als natürlichen Personen sind Ausbildungs- und Berufsqualifikationen. Dafür ist erforderlich, dass der Junglandwirt oder die maßgebliche Person alternativ oder kumulativ:
- über eine bestandene Abschlussprüfung in einem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf des Ausbildungsbereichs Landwirtschaft („Grüne Berufe“, https://www.bildungsserveragrar.de/bildungswege/ausbildung/berufsportraets/) oder einen Studienabschluss im Bereich Agrarwirtschaft verfügt,
- erfolgreich an von den zuständigen Stellen der Länder anerkannten Bildungsmaßnahmen im Agrarbereich zur Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten zur Führung eines landwirtschaftlichen Betriebs in einem Umfang von mindestens 300 Stunden teilgenommen hat oder
- mindestens zwei Jahre in einem oder mehreren landwirtschaftlichen Betrieben tätig war
a) aufgrund eines Arbeitsvertrages mit einer vereinbarten regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von mindestens 15 Stunden,
b) als mithelfende Familienangehörige oder mithelfender Familienangehöriger im Rahmen einer krankenversicherungspflichtigen Beschäftigung oder
c) als Gesellschafterin oder Gesellschafter eines landwirtschaftlichen Betriebsinhabers mit einer im Rahmen des Gesellschaftsvertrags vereinbarten regelmäßigen wöchentlichen Leistung von Diensten im Umfang von mindestens 15 Stunden.
Der Tätigkeitszeitraum von zwei Jahren kann auch durch Kombination der in Buchstaben a bis c genannten Tätigkeiten erfüllt werden.
Die Erfüllung dieser Voraussetzungen zum Antragszeitpunkt ist durch die Vorlage geeigneter Belege, wie zum Beispiel von Abschlusszeugnissen, Teilnahmebescheinigungen, Gesellschaftsverträgen, Belegen über sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse im familiären Betrieb oder Arbeitsverträgen, nachzuweisen.
Die Übernahme und selbstständige Bewirtschaftung eines landwirtschaftlichen Betriebes allein erfüllt die Anforderungen der beruflichen Qualifikation nicht.
Haben mehrere für die Einordnung als Junglandwirt in Betracht kommende natürliche Personen zu unterschiedlichen Zeitpunkten die Kontrolle übernommen, so wird nur die erste Aufnahme der Kontrolle berücksichtigt. Übt keine der natürlichen Personen, die den Betriebsinhaber im Jahr der ersten Antragstellung für die Junglandwirte-Einkommensstützung kontrolliert haben und die die notwendigen Anforderungen an eine maßgebliche Person erfüllen, mehr die Kontrolle über den Betriebsinhaber aus, kann die Junglandwirte-Einkommensstützung nicht mehr gewährt werden.Beantworten Sie zunächst die grundsätzliche Frage nach der Beantragung der Auszahlung der Junglande-Einkommensstützung. Im Folgenden sind dann weitere Angaben zur Antragstellung zu machen.
3.3.1 unveränderte Antragstellung
Betriebsinhaber, die bereits in Vorjahren (auch in der letzten Förderperiode) die Zahlungen für Junglandwirte erhalten haben, aber die maximale Förderdauer von fünf Jahren noch nicht erreicht haben, können für den noch verbleibenden Zeitraum die Junglandwirte-Einkommensstützung beantragen.
Hierbei gilt für diejenigen, die bereits in der letzten Förderperiode die Junglandwirte-Förderung bezogen haben: Die in der letzten Förderperiode an den Betriebsinhaber gestellten Anforderungen sind weiterhin zu erfüllen. Bei Betriebsinhabern, die keine natürliche Person sind, bedeutet dies insbesondere, dass eine der maßgeblichen natürlichen Personen, die zu Beginn des Förderzeitraums die juristische Person oder Vereinigung natürlicher Personen (z. B. eine GbR) kontrolliert hat, weiterhin die Kontrolle über den Betriebsinhaber ausübt. Die ab dem Jahr 2023 geltenden Anforderungen an die berufliche Qualifikation von Junglandwirten oder maßgebliche Personen müssen sie jedoch nicht erfüllen.
Diejenigen Betriebsinhaber, denen ab Beginn der neuen Förderperiode die Junglandwirte-Einkommensstützung gewährt wurde, mussten das Vorliegen der Voraussetzungen mit erstmaliger Antragstellung nachweisen. Sofern keine Änderungen eingetreten sind, die die Betriebskontinuität betreffen, ist die Antragstellung unverändert.
Hinweis: Wenn der Betriebsinhaber eine juristische Person oder Personengesellschaft ist, ist ein Wechsel der maßgeblichen Person in dem 5-Jahres Zeitraum möglich. Dies allerdings nur, wenn die als "Nachrücker" vorgesehene natürliche Person den Betriebsinhaber im Jahr der ersten Antragstellung für die Junglandwirte-Einkommensstützung kontrolliert hat, die notwendigen Anforderungen an eine maßgebliche Person erfüllt und bei der erstmaligen Beantragung der Junglandwirte-Einkommensstützung bereits auf dem Datenbegleitschein bzw. in ANDI als zusätzlicher Junglandwirt/maßgebliche Person benannt wurde.
3.3.2 Erstmalige Antragstellung:
Die natürliche Person oder die maßgebliche Person hat bisher noch keine Junglandwirteförderung erhalten, hat sich erstmals in einem landwirtschaftlichen Betrieb als Betriebsleiter niedergelassen und kann damit unter 3.3.2 erstmalig die Auszahlung der Junglandwirte-Einkommensstützung beantragen.
In Falle der erstmaligen Antragstellung sind als erstes Angaben die persönlichen Angaben zur natürlichen Person des Junglandwirtes als Betriebsleiter zu machen: Name, Adresse, persönliche Daten, Registriernummer des Junglandwirtes sowie das Datum der erstmaligen Niederlassung als Betriebsleiter. Handelt es sich beim Betriebsinhaber um eine natürliche Person, ist die anzugebende Registriernummer des Junglandwirtes identisch mit der Antragsregistriernummer. Im Falle des Betriebsinhabers als juristische Person oder Personengesellschaft benötigt der Junglandwirt eine eigene Registriernummer für seine Person.
Ferner ist die abgeschlossene berufliche Qualifikation in einem anerkannten landwirtschaftlichen Ausbildungsberuf oder einem Studienabschluss in Bereich der Agrarwirtschaft zum Zeitpunkt der Beantragung mitzuteilen und nachzuweisen. Alle Nachweise hierzu müssen der zuständigen Bewilligungsstelle der LWK Niedersachsen bis spätestens zum 31.05. des Antragsjahres vorliegen.
Unter Ziffer 3.3.3.1 müssen Sie den Haken setzen, wenn Sie den Antrag als natürliche Person stellen. In diesem Fall ist der Betriebsinhaber mit dem Junglandwirt identisch. Das bedeutet auch, dass die Registriernummer des Betriebes mit der Registriernummer des Junglandwirts identisch ist.
Unter Ziffer 3.3.3.2 müssen Sie den Haken setzen, wenn Sie den Antrag als juristische Person oder unter Ziffer 3.3.3.3 als Personengesellschaft stellen. In diesem Fall ist die juristische Person oder Personengesellschaft der Betriebsinhaber und der Junglandwirt die "maßgebliche" Person, die die Junglandwirte-Einkommensstützung auslöst. In diesem Fall benötigt der Junglandwirt eine eigene Registriernummer, da der Antrag unter der Registriernummer des Betriebsinhabers gestellt wird.
Entsprechende Nachweise der wirksamen und langfristigen Kontrolle durch den Junglandwirt im begünstigten Unternehmen sind dem Datenbegleitschein zum Sammelantrag beizufügen. Bei einer Authentifizierung über die BundID oder MUK ist das Vorliegen der Qualifikation zum Antragszeitpunkt der zuständigen Bewilligungsstelle durch Vorlage entsprechender Belege bis spätestens zum 31.05. des Antragsjahres nachzuweisen.
Sollten zusätzliche Junglandwirte/maßgebliche Personen in dem Unternehmen vorhanden sein, sind diese in ANDI anzugeben.
Ökoregelungen
Der Großteil der Ökoregelungen wird direkt in der Flächenbearbeitung für die einzelnen Schläge / Teilschläge ausgewählt und unter der Ziffer 3.4 Ökoregelugen nur angezeigt. Lediglich ÖR 2 und ÖR 4, die gesamtbetrieblich gelten, sind hier unter 3.4 zu beantragen. Eine neue Beantragung von ÖR nach dem 31.05. ist nicht zulässig.
Die Ökoregelungen sind ein zentrales und neues Element der Gemeinsamen Agrarpolitik in der Förderperiode 2023 bis 2027. Sie bilden mit der Konditionalität und den Agarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) der 2. Säule eines der drei Kernelemente der sogenannten Grünen Architektur der GAP. Über die Ökoregelungen werden auf Antrag bestimmte Leistungen für Umwelt und Klima, die insbesondere über die Konditionalität hinaus gehen, honoriert. Betriebsinhaber, die sich für eine Teilnahme entscheiden, können eine Zahlung für diese Verpflichtungen - mit Ausnahme der Ökoregelung Nr. 7 - auch unabhängig von einem Antrag auf Einkommensgrundstützung erhalten.
Es ist möglich, mehrere Ökoregelungen in einem Betrieb und teilweise auch auf der derselben Fläche durchzuführen und entsprechend zu beantragen. Das heißt, die Ökoregelungen sind grundsätzlich, wenn auch mit Ausnahmen, miteinander kombinierbar.
Kombinierbarkeit der Ökoregelungen auf derselben Fläche:
| ÖR 1a | ÖR 1b | ÖR 1c | ÖR 1d | ÖR 2 | ÖR 3 | ÖR 4 | ÖR 5 | ÖR 6 | ÖR 7 | |
| ÖR 1a | x | x | - | - | - | - | - | - | - | x |
| ÖR 1b | x | x | - | - | - | - | - | - | - | x |
| ÖR 1c | - | - | x | - | - | - | - | - | - | x |
| ÖR 1d | - | - | - | x | - | () | x | x | - | x |
| ÖR 2 | - | - | - | - | x | x | - | - | x | x |
| ÖR 3 | - | - | - | () | x | x | x | x | x | x |
| ÖR 4 | - | - | - | x | - | x | x | x | - | x |
| ÖR 5 | - | - | - | x | - | x | x | x | - | x |
| ÖR 6 | - | - | - | - | x | x | - | - | x | x |
| ÖR 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Dabei gilt:
x = auf derselben Fläche kombinierbar
- = nicht auf derselben Fläche kombinierbar
() = hier ist eine Kombination der Maßnahmen auf demselben Schlag möglich, die Altgrasstreifen liegen zwischen den Gehölzflächen
Nicht-Kombinierbarkeit liegt in zwei Fällen vor:
1) Die Flächenkategorien passen nicht zusammen: Eine Dauergrünlandmaßnahme kann nicht auf einer Ackerlandfläche stattfinden und umgekehrt und eine Dauerkulturmaßnahme kann nur auf einer Dauerkulturfläche stattfinden.
2) Eine nichtproduktive Fläche kann nicht gleichzeitig an einer Maßnahme für produktive Flächen teilnehmen.
Neben den Ökoregelungen bestehen auch weiterhin die Förderangebote der AUKM der 2. Säule. Auch AUKM können in vielen Fällen im Betrieb oder sogar auf derselben Fläche mit Ökoregelungen kombiniert werden. Deshalb können sowohl konventionell als auch ökologisch wirtschaftende Betriebe Ökoregelungen beantragen. Zu beachten ist allerdings, dass bei der Kombination einer Ökoregelung mit einer AUKM die gleiche Leistung nicht doppelt gefördert werden darf (Doppelfinanzierungsverbot). Daher muss, wenn eine Förderverpflichtung einer AUKM bereits durch eine Ökoregelung entlohnt wird, die Prämie der AUKM um einen entsprechenden Betrag reduziert werden. Dies gilt auch für die Förderung des Öko-Landbaus aus der 2. Säule. Eine Doppelfinanzierung wird damit von vornherein ausgeschlossen. Die aktuellen Kombinationstabellen sind unter "" in ANDI zu finden.
Ökoregelung 1 - Bereitstellung von Flächen zur Verbesserung der Biodiversität und Erhaltung von Lebensräumen:
Diese Ökoregelung hilft, Lebensräume für eine Vielzahl von Pflanzen und Tierarten bereitzustellen. Durch den Verzicht auf eine Bewirtschaftung können sich Pflanzenarten etablieren und vermehren, die auf dem Acker- oder im Grünland sonst wenig Entwicklungsmöglichkeiten haben. Gleichzeitig bieten diese nicht bewirtschafteten Flächen Lebensraum für Insekten und Feldvögel und ab einer gewissen Wuchshöhe auch Schutz für kleinere Säugetiere. Die Flächen bieten insbesondere dann Lebensraum, wenn sie mehrjährig auf einer Fläche mit möglichst wenig Nutzung angelegt werden. Darüber hinaus trägt die Ökoregelung zu einer reduzierten Anwendung von Pflanzenschutzmitteln bei.
Ökoregelung 1a - Nichtproduktive Flächen auf Ackerland:
Um eine Unterstützung für die Verpflichtungen der Ökoregelung 1a zu erhalten, sind nicht produktive Flächen auf förderfähigem Ackerland bereitzustellen.
Begünstigungsfähig sind in 2025 bis zu 8% anstatt wie bisher 6% des förderfähigen Ackerlandes (bzw. im Falle von nur einem Hektar ggf. auch mehr). Ein darüberhinausgehender Anteil an Brachflächen ist keine Fläche nach der Ökoregelung 1a.
Die Prämienstaffelung bleibt erhalten. Das heißt, die zusätzlichen zwei Prozent werden die dritte Prämienstufe erweitern, so dass weiterhin für die über den Umfang von 2% hinausgehende ÖR 1a-Fläche die dritte Prämienstufe von 300 € je ha gelten wird (falls nicht die sogenannte 1-Hektar-Regel greift).
Aufgrund von Änderungen bezüglich der Vorgaben zur aktiven Begrünung bei der Öko-Regelung 1a waren Änderungen in der Beantragung erforderlich. Es ist nun am Schlag mit der Öko-Regelung anzugeben, ob die Begrünung als aktive Begrünung (Nutzungscode 590) oder durch Selbstbegrünung (Nutzungscode 591) erfolgt. Im Fall einer aktiven Begrünung durch Aussaat muss die Saatgutmischung mindestens fünf krautartige zweikeimblättrige Arten enthalten. Durch Auswahl des NC 590 erklären Sie, eine solche Saatgutmischung zu verwenden.
Nicht beantragbar für die Ökoregelung 1a sind:
a) Landschaftselemente, die im Rahmen des GLÖZ-Standards 8 (Verbot der Beseitigung bestimmter Landschaftselemente) geschützt sind wie zum Beispiel bestimmte Bäume oder Hecken,
b) Ackerland, auf dem sich ein Agroforstsystem befindet.
Wichtiger Hinweis: Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung festlegen, dass bestimmte Flächen für diese Ökoregelung nicht in Betracht kommen.
Begünstigungsfähig ist eine nichtproduktive Fläche, die folgende Voraussetzungen erfüllt:
a) Die nichtproduktive Fläche muss mindestens 0,1 Hektar groß sein (Mindestparzellengröße).
b) Die nichtproduktive Fläche muss brachliegen und der Selbstbegrünung überlassen werden oder durch Aussaat begrünt werden. Zur Begrünung durch Aussaat muss die Saatgutmischung mindestens fünf krautartige zweikeimblättrige Arten enthalten.
c) Auf einer nichtproduktiven Fläche dürfen keine Düngemittel einschließlich Wirtschaftsdünger und keine Pflanzenschutzmittel angewendet werden.
d) Die Brache muss während des ganzen Antragsjahres (01.01. bis 31.12.) erhalten bleiben. Der Zeitraum der Brache und Bearbeitungsruhe beginnt zum 1. Januar des Antragsjahres. Abweichend darf ab dem 1. September des Antragsjahres eine Aussaat oder Pflanzung, die nicht vor Ablauf dieses Jahres zur Ernte führt, vorbereitet und durchgeführt oder der Aufwuchs durch Schafe oder Ziegen beweidet werden. Eine Aussaat von Winterraps oder Wintergerste darf bereits ab dem 15. August vorbereitet und durchgeführt werden. Sollten bei der Aussaat oder Pflanzung Dünge- oder Pflanzenschutzmittel ausgebracht werden, sind ggf. Einschränkungen über das Fachrecht zu beachten.
Auf einer brachliegenden Fläche muss die Mindesttätigkeit nur alle 2 Jahre erbracht werden. Wenn die Mindesttätigkeit durch Mähen erbracht wird, ist das Mähgut abzufahren und darf nicht für eine landwirtschaftliche Erzeugung verwendet werden. Es darf also z. B. weder verfüttert noch für die Biogaserzeugung verwendet werden. Im Zeitraum vom 1. April bis zum 15. August ist das Mähen oder Zerkleinern des Aufwuchses durch die Sperrfrist der Konditionalität (GLÖZ 6) auf brachliegendem Ackerland verboten.
Die Ökoregelung 1a kann mehrere Jahre hintereinander auf derselben Fläche durchgeführt werden.
Vorgewende sind keine brachliegenden Flächen und können nicht als Ökoregelung 1a-Brachen angerechnet werden.
Betriebe mit mehr als zehn Hektar Ackerland, können unabhängig von der Prämienstruktur für bis zu einem Hektar die Prämie der ersten Stufe (1.300 Euro/ha) beziehen, auch wenn dadurch mehr als acht Prozent stillgelegt würden.
Ökoregelung 1b - Anlage von Blühstreifen und -flächen auf Ackerland:
Ökoregelung 1b kann in Kombination mit Ökoregelung 1a beantragt werden (als sogenanntes Top-up)
Abweichungen von der Mindestbreite sind unschädlich, solange die Vorgabe auf der überwiegenden Länge eingehalten wird. Um die Ökoregelung 1b beantragen zu können, wählen Sie zuerst ÖR 1a aus und gehen dann auf „Weitere hinzufügen“. Erst dann wird Ihnen die ÖR 1b angeboten, die Sie dann hinzufügen können.
Eine weitere Änderung, die sich auch auf die Beantragung der auf ÖR 1a/b auswirkt, ist, dass eine landwirtschaftliche Tätigkeit nur noch in jedem zweiten Jahr erfolgen muss.
Zur besseren Nachvollziehbarkeit ist bei Beantragung dieser ÖR nun zusätzlich die Angabe des Ansaatjahres erforderlich. Die entsprechenden Saatgutbelege (Saatgutetikett und Kaufbeleg) reichen Sie bitte mit Antragstellung, spätestens jedoch bis zum 30.09. des Antragsjahres, bei der zuständigen Bewilligungsstelle ein. Nutzen Sie hierfür gern den Dokumentenupload.
Wichtiger Hinweis:
Für die Öko-Regelung nach § 20 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b (ÖR 1b) des GAP-Direktzahlungen-Gesetzes werden gemäß § 17 Absatz 4 der GAP-Direktzahlungen-Verordnung Ausschlussgebiete festgelegt. Ausgeschlossen werden Gebiete, in denen eine Antragstellung für die Agrarumwelt- und Klimamaßnahme „AN 4 - Naturschutzgerechte Bewirtschaftung zum Schutz von Ackerwildkräutern“ nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung einer nachhaltigen und umwelt-, klima- sowie naturschutzgerechten Bewirtschaftung von landwirtschaftlich genutzten Flächen in Bremen, Hamburg und Niedersachsen zugelassen ist. Die entsprechende Kulisse mit Flächen für die der Ausschluss im Sinne des Satzes 2 greift, wird jährlich im Rahmen des Antragsverfahrens bekannt gegeben.
Sowohl für Blühstreifen als auch für Blühflächen gelten folgende weitere Voraussetzungen: Der Blühstreifen/ die Blühfläche muss mit einer Saatgutmischung entsprechend des Artenkatalogs für die Ökoregelung 1b etabliert worden sein, wobei folgende Mischungsregeln beachtet werden müssen: Eine einjährige Mischung muss aus mindestens 10 Arten der Gruppe A aus dem Artenkatalog für die Ökoregelung 1 b bestehen, die zusätzlich durch Arten aus Gruppe B ergänzt werden können. Alternativ kann die Blühmischung aus mindestens 5 der in Gruppe A und mindestens 5 der in Gruppe B aufgeführten Arten bestehen (mehrjährige Mischung).
Wichtiger Hinweis: Niedersachsen hat von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, für die Öko-Regelungen nach § 20 Absatz 1 Nummer 1 Buchstaben b und c des GAP-Direktzahlungen-Gesetzes gemäß § 17 Absatz 5 der GAP-Direktzahlungen-Verordnung abweichende Arten festzulegen. Die zulässigen Arten für Saatgutmischungen sind abweichend von Anhang 1 der Anlage 5 zur GAPDZV in der Anlage 2 zur Niedersächsische Verordnung über die Ausführung der Direktzahlungen und des Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems (NDZInVeKoSAV) festgelegt. Die Liste der zulässigen Saatgutmischungen für ÖR 1b und 1c finden Sie unter "Dokumente und Formulare".
Es ist nachzuweisen, dass nur die zulässigen Arten verwendet werden. Die entsprechenden Saatgutbelege sind mit Antragstellung bei der zuständigen Bewilligungsstelle einzureichen. Nutzen Sie hierfür gern den Dokumentenupload.
Es dürfen keine Düngemittel, Wirtschaftsdünger oder Pflanzenschutzmittel ausgebracht werden.
Die Aussaat hat bis zum 15. Mai des Antragsjahres zu erfolgen, kann aber auch schon im Vorjahr erfolgen. Im Fall einer erneuten Beantragung derselben Fläche ist der 15. Mai des ersten Antragsjahres spätester Aussaattermin.
Im ersten Antragsjahr muss der Blühstreifen / die Blühfläche bis einschließlich zum 31. Dezember erhalten werden.
Eine Fläche kann in dem Jahr, das auf das erste Antragsjahr folgt ohne erneute Aussaat wieder beantragt werden, wenn bei der Aussaat eine entsprechende Mischung (siehe oben „mehrjährige Mischung“) verwendet wurde. In dem Fall ist ab dem 1. September des zweiten Antragsjahres eine Bodenbearbeitung mit folgender Aussaat oder die Pflanzung einer Folgekultur erlaubt, die nicht vor Ablauf des Antragsjahres zu einer Ernte führt.
Auf Flächen, die in die Ökoregelung 1 einbezogen werden, ist die Mindesttätigkeit nur in jedem zweiten Jahr durchzuführen. Dies wird bereits durch die Erhaltungstätigkeit im ersten Jahr durch die Ansaat der Blühmischung erfüllt. Um die Vorgaben bezüglich der Mindesttätigkeit zu erfüllen, muss eine zweijährige Blühfläche der Ökoregelung 1b im zweiten Jahr daher nicht gemulcht werden.
Zur besseren Nachvollziehbarkeit ist bei der Beantragung dieser Ökoregelung nun zusätzlich die Angabe des Ansaatjahres erforderlich.
Die Bewertung der Mindesttätigkeit auf Brachen wird im Schlaginfo Portal dargestellt. Bitte beachten Sie diese Bewertungen.
Ökoregelung 1c - Anlage von Blühstreifen und -flächen in Dauerkulturen:
Für begünstigungsfähige Blühstreifen und -flächen in förderfähigen Dauerkulturen gelten die Voraussetzungen von Ökoregelung 1b entsprechend, unter anderem auch die Vorgaben für die Blühmischung und dass der Aufwuchs im Antragsjahr nicht gemäht oder gemulcht werden darf. Es gibt gegenüber Ökoregelung 1b die Ausnahmen, dass die Blühstreifen bzw. -flächen in Dauerkulturen keine Mindestgröße von 0,1 Hektar haben müssen und dass sie schmaler als 20 Meter sein dürfen.
Sie können auch als Zwischenzeilenbegrünung angelegt werden. Dabei ist zu beachten, dass die Blühstreifen deutlich als solche erkennbar sein müssen. Sollte die Bewirtschaftung der Dauerkultur das Aufgehen und das Blühen der entsprechenden Blühpflanzen auf dem Streifen beispielsweise durch häufiges Überfahren verhindern, kann der Streifen nicht für die Ökoregelung 1c anerkannt werden.
Wichtiger Hinweis: Niedersachsen hat von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, für die Öko-Regelungen nach § 20 Absatz 1 Nummer 1 Buchstaben b und c des GAP-Direktzahlungen-Gesetzes gemäß § 17 Absatz 5 der GAP-Direktzahlungen-Verordnung abweichende Arten festzulegen. Die zulässigen Arten für Saatgutmischungen sind abweichend von Anhang 1 der Anlage 5 zur GAPDZV in der Anlage 2 zur Niedersächsische Verordnung über die Ausführung der Direktzahlungen und des Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems (NDZInVeKoSAV) festgelegt. Die Liste der zulässigen Saatgutmischungen für ÖR 1b und 1c finden Sie unter "Dokumente und Formulare".
Ökoregelung 1d - Altgrasstreifen oder -flächen in Dauergrünland:
Die nach Ökoregelung 1d begünstigungsfähige Altgrasstreifen oder -flächen in Dauergrünland müssen mindestens 1 Prozent des förderfähigen Dauergrünlands des Betriebs umfassen. Begünstigungsfähig sind höchstens 6 Prozent des förderfähigen Dauergrünlands des Betriebs.
Analog zur 1-Hektar-Regelung der ÖR 1a sind Altgrasstreifen oder –flächen im Umfang von bis zu einem Hektar auch dann begünstigungsfähig, wenn diese mehr als sechs Prozent des förderfähigen Dauergrünlands des Betriebs ausmachen. Für diesen Hektar wird die höchste Prämien-stufe (900 EUR/ha) gewährt werden.
Die Flächen müssen in Bezug auf den jeweiligen Schlag folgende Voraussetzungen erfüllen:
a) Der Schlag oder Teilschlag, der für den Altgrasstreifen/die Altgrasfläche in Dauergrünland genutzt wird, muss die Mindestgröße von 0,1 ha erfüllen.
b) Bis zu einer Schlaggröße von 0,3 ha ist der Streifen als eigener Schlag beantragbar. Bei Flächengrößen über 0,3 ha müssen mindestens 2 Teilschläge vorhanden sein. Die ÖR1d-Flächen des Dauergrünland-Schlages, die in der Summe größer als 0,3 ha sind, sind höchstens im Umfang von 20 Prozent des Dauergrünland-Schlages begünstigungsfähig. Die Altgrasfläche muss weiterhin abgrenzbar sein. Die Altgrasfläche darf das ganze Jahr über nicht gemulcht werden, d. h. es darf keine Zerkleinerung und ganzflächige Verteilung vorgenommen werden.
c) Die Verpflichtung, den Standort des Altgrasstreifens bzw. der Altgrasfläche alle zwei Jahre zu ändern, entfällt. Es wird aus Naturschutzgründen aber empfohlen, den Standort zu wechseln.
d) Altgrasstreifen müssen grundsätzlich das ganze Antragsjahr vorliegen. Abweichend davon ist ab dem 1. September nur eine Beweidung oder Schnittnutzung notwendig, da es sich um produktives Dauergrünland handelt. Mulchen (Zerkleinerung und ganzflächige Verteilung) ist nicht zulässig.
Der Altgrasstreifen unterliegt einer landwirtschaftlichen Tätigkeit und muss landwirtschaftlich genutzt werden. Eine lediglich alle 2 Jahre stattfindende Mindesttätigkeit reicht nicht aus und führt zur Aberkennung der Förderfähigkeit in dem Jahr, in dem keine landwirtschaftliche Tätigkeit erfolgt ist.
Wichtiger Hinweis: Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung festlegen, dass bestimmte Flächen für diese Ökoregelung nicht in Betracht kommen. Niedersachsen hat hierzu keine speziellen Regelungen getroffen.
Ökoregelung 2 - Anbau vielfältiger Kulturen mit mindestens fünf Hauptfruchtarten im Ackerbau einschließlich des Anbaus von Leguminosen mit einem Mindestanteil von 10%:
Die Vielfalt der Kulturen kann zur Verbesserung oder Bewahrung der Bodenqualität beitragen. Insbesondere durch die Integration der Leguminosen wird die Humusbildung und Stickstofffixierung gefördert. Damit kann diese Ökoregelung auch zur Reduzierung des Stickstoffdüngemitteleinsatzes führen, die Bodenfruchtbarkeit verbessern und folglich auch zum Klimaschutz beitragen.
Begünstigungsfähig ist förderfähiges Ackerland mit Ausnahme des brachliegenden Ackerlandes, das folgende Voraussetzungen erfüllt:
a) Auf dem förderfähigen Ackerland des Betriebs mit Ausnahme des brachliegenden Ackerlandes sind mindestens fünf verschiedene Hauptfruchtarten im Antragsjahr anzubauen. Diese Verpflichtung gilt auch als erfüllt, wenn auf mindestens 40 Prozent des förderfähigen Ackerlands mit Ausnahme des brachliegenden Ackerlands des Betriebs beetweise mindestens fünf verschiedene Gemüsekulturen, Küchenkräuter, Heil-, Gewürz- oder Zierpflanzen angebaut werden.
b) Jede Hauptfruchtart muss auf mindestens 10 Prozent und darf auf höchstens 30 Prozent der Fläche angebaut werden. Bei dem Anbau von mehr als fünf Hauptfruchtarten werden zur Berechnung dieser Mindestanteile Hauptfruchtarten zusammengefasst.
c) Es müssen mindestens 10 Prozent Leguminosen einschließlich deren Gemenge, bei denen Leguminosen auf der Fläche überwiegen, angebaut werden. Dabei sind sowohl klein- als auch grobkörnige Leguminosen möglich.
d) Als Hauptkulturen gelten:
• landwirtschaftliche Kulturpflanzen verschiedener in der botanischen Klassifikation definierten Gattung
• Jede Art im Fall der Gattungen Brassicaceae (Kreuzbl¸tler), Solanaceae (Nachtschattengewächse) und Cucurbitaceae (Kürbisgewächse)
• Gras oder andere Grünfutterpflanzen
Zudem gelten folgende Regelungen:
• Alle Mischkulturen von feinkörnigen Leguminosen oder von feinkörnigen Leguminosen mit anderen Pflanzen, sofern feinkörnige Leguminosen überwiegen, zählen zu der einzigen Hauptfruchtart feinkörnige Leguminosenmischkultur
• Alle Mischkulturen von grobkörnigen Leguminosen oder von grobkörnigen Leguminosen mit anderen Pflanzen, sofern grobkörnige Leguminosen überwiegen, zählen zu der einzigen Hauptfruchtart grobkörnige Leguminosenmischkultur
• Sommer- und Wintermischkultur: alle Mischkulturen, die nicht unter Gras oder andere Grünfutterpflanzen und Leguminosenmischkulturen fallen, und durch Aussaat einer Saatgutmischung oder Aussaat oder Anpflanzung mehrerer Kulturpflanzen in getrennten Reihen etabliert wurden
• Dinkel (Triticum spelta) gilt als unterschiedliche Hauptfruchtart gegenüber Hauptfruchtarten, die zu derselben Gattung gehören. (Dinkel gilt als eine andere Kulturart als Weizen.)
• Der Anteil von Getreide an dem förderfähigen Ackerland mit Ausnahme des brachliegenden Ackerlandes darf höchstens 66 Prozent der förderfähigen Fläche betragen. Mais und Hirse werden bei der Ermittlung des Getreideanteils nicht gewertet.
Zur besseren Berücksichtigung der Kulturvielfalt des "beetweisen Anbaus" sind Unterscheidungen bei der Anzahl der erforderlichen Hauptfruchtarten erfolgt. Neben den bisherigen Nutzungscodes für den beetweisen Anbau (NC, 610, 650 und 720) wurden neue Nutzungscodes geschaffen (NC 611, 690 und 718), um darstellen zu können, dass jeweils bis zu vier Kulturen oder fünf und mehr Kulturen angebaut werden.
Eine detaillierte Einstufung zu den Hauptfruchtarten finden Sie in der NC-Tabelle 2025 (Kulturcodes) zu ÖR 2 unter "Dokumente und Formulare" in ANDI 2025.
Die festgestellte Kultur wird im Schlaginfo Portal angezeigt – wird hier eine abweichende Kultur angezeigt, wenden Sie sich bitte an die zuständige Bewilligungsstelle der LWK Niedersachsen.
Ökoregelung 3 - Beibehaltung einer agroforstlichen Bewirtschaftungsweise auf Ackerland und Dauergrünland:
Diese Ökoregelung soll insbesondere zum Klimaschutz dadurch beitragen, dass Kohlenstoff in Holz, Wurzeln und im Boden festgelegt wird und zumindest über einige Jahre nicht als Kohlenstoffdioxid (CO2) zum Treibhauseffekt beiträgt. Die Agroforstwirtschaft kann zudem vielfältige weitere positive Wirkungen haben, wie zum Beispiel Humusaufbau und Verbesserung des Bodenlebens, reduzierte Verdunstung durch Beschattung und Windschutz, Erosionsvermeidung, Reduzierung von Stoffaustrag in Gewässer sowie Anreicherung der Lebensräume in Agrarlandschaften.
Voraussetzung für die Ökoregelung 3 ist, dass ein Agroforstsystem mit streifenförmigem Anbau vorliegt, bei verstreutem Anbau ist die Öko-Regelung 3 nicht zulässig.
Für die Beantragung ist es nicht mehr erforderlich, dass ein positiv geprüftes/ genehmigtes Nutzungskonzept vorgelegt wird. Es sind aber die unter dem Punkt "Agroforst" dargestellten Angaben und Erklärungen abzugeben.
In Bezug auf die Beibehaltung einer agroforstlichen Bewirtschaftungsweise in einem Agroforstsystem auf Ackerland oder Dauergrünland im Rahmen der Ökoregelung ist die Fläche der Gehölzstreifen auf einer förderfähigen Ackerland- oder Dauergrünlandfläche begünstigungsfähig, die außerdem die folgenden Voraussetzungen erfüllt:
a) Der Flächenanteil der Gehölzstreifen auf einer förderfähigen Ackerland- oder Dauergrünlandfläche muss zwischen 2 und 40 Prozent betragen.
b) Die Gehölzstreifen müssen weitestgehend durchgängig mit Gehölzen bestockt sein.
c) Es müssen mindestens zwei Gehölzstreifen auf einer Fläche stehen.
d) Die Breite der einzelnen Gehölzstreifen darf auf der überwiegenden Länge nicht mehr als 25 Meter betragen. Die Mindestbreite von 3 Metern wurde gestrichen. Die Breite der Gehölzstreifen bezieht sich auf den gesamten Streifen, inklusive einer die Gehölze umgebende Fläche, die nicht bewirtschaftet wird, sofern die Breite dieser Fläche im Hinblick auf die weitere Entwicklung der Gehölze plausibel ist. Erforderlich ist eine klar erkennbare Grenze zwischen dem Agroforstgehölzstreifen (einschließlich der beschriebenen umgebenden Fläche) und der übrigen landwirtschaftlichen Fläche.
e) Der größte Abstand zwischen zwei Gehölzstreifen sowie zwischen einem Gehölzstreifen und dem Rand der Fläche darf auf der überwiegenden Länge nicht mehr als 100 Meter betragen.
f) Der kleinste Abstand zwischen zwei Gehölzstreifen muss auf der überwiegenden Länge 20 Meter betragen. Der kleinste Abstand von Gehölzstreifen zu einem Waldrand oder zu einem in § 23 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 der GAP-Konditionalitäten-Verordnung genannten Landschaftselement darf auf der überwiegenden Länge nicht weniger als 20 Meter betragen.
g) Unbeschadet naturschutzrechtlicher Vorschriften sind Maßnahmen der Holzernte im Antragsjahr nur in den Monaten Januar, Februar und Dezember zulässig.
Durch eine Negativliste werden nachteilige invasive Gehölze von der Förderung ausgeschlossen. Für ab dem 1. Januar 2022 neu angelegte Agroforstsysteme gilt außerdem, dass sie die folgenden Gehölzarten nicht enthalten dürfen.
| Botanische Bezeichnung | Deutsche Bezeichnung |
| Acer negundo | Eschen-Ahorn |
| Buddleja davidii | Schmetterlingsstrauch |
| Fraxinus pennsylvanica | Rot-Esche |
| Prunus serotina | Späte Traubenkirsche |
| Rhus typhina | Essigbaum |
| Robinia pseudoacacia | Robinie |
| Rosa rugosa | Kartoffel-Rose |
| Symphoricarpos albus | Gewöhnliche Schneebeere |
| Quercus rubra | Roteiche |
| Paulownia tomentosa | Blauglockenbaum |
Für Agroforstsysteme, die nach dem 31. Dezember 2024 angelegt werden gilt ein Ausschluss nicht steriler Hybride von Paulownia tomentosa.
Wichtiger Hinweis: Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung festlegen, dass bestimmte Flächen für diese Öko-Regelung nicht in Betracht kommen. Niedersachsen hat hierzu keine speziellen Regelungen getroffen. Informationen dazu, wie Sie ein Agroforstsystem in ANDI angeben, finden Sie im Bereich der Flächenbearbeitung.
Ökoregelung 4 - Extensivierung des gesamten Dauergrünlandes des Betriebs:
Die extensive Bewirtschaftung des Dauergrünlandes durch Begrenzung des Viehbesatzes sowie des Düngereinsatzes führt zur Reduktion von Stickstoffemissionen und trägt dadurch zum Gewässer- und infolge verringerter Treibhausgasemissionen auch zum Klimaschutz bei. Durch das Pflugverbot wird zudem Kohlenstoff im Boden angereichert. Schließlich wird dadurch ein Beitrag zum Erhalt und zur Schaffung von Lebensräumen für zahlreiche Pflanzen- und Tierarten geleistet.
Begünstigungsfähig ist das gesamte förderfähige Dauergrünland eines Betriebs, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
a) Im Gesamtbetrieb ist vom 1. Januar bis zum 31. Dezember des Antragsjahres durchschnittlich ein Viehbesatz von mindestens 0,3 und höchstens 1,4 raufutterfressenden Großvieheinheiten (RGV) je Hektar förderfähigen Dauergrünlands einzuhalten.
Ab 2025 werden auch Dam- und Rotwild bei der Berechnung der rauhfutterfressenden Großvieheinheiten berücksichtigt.
Zur Erbringung des RGV-Besatzes werden somit ausschließlich die im Betrieb gehaltenen Rinder, Schafe, Ziegen, Equiden (z.B. Pferde, Ponys etc.) sowie ab dem Antragsjahr 2025 auch Dam- und Rotwild herangezogen. Über die folgenden Umrechnungsschlüssel werden die im Betrieb gehaltenen Tiere (einschließlich Pensionstiere) in Großvieheinheiten (GVE) umgerechnet und zu den oben genannten Viehbesatzdichten gezählt:
Bullen, Kühe und sonstige Rinder über zwei Jahre, Equiden über sechs Monate: 1,0 GVE
Rinder von sechs Monaten bis zwei Jahren: 0,6 GVE
Rinder unter sechs Monaten: 0,4 GVE
Schafe und Ziegen: 0,15 GVE (Lämmer sind von den angegebenen RGV für die Kategorie „Schafe/Ziegen“ mit umfasst.)
Damwild: 0,15 GVE
Rotwild: 0,3 GVE
Es können auch andere raufutterfressende Tiere gehalten werden. Diese werden nicht in der Berechnung zum durchschnittlichen Viehbesatz berücksichtigt, in Bezug auf den Dunganfall (siehe nachfolgend Buchstabe b) aber schon.
b) Die Verwendung von Düngemitteln einschließlich Wirtschaftsdüngern ist nur in dem Umfang erlaubt, der dem Dunganfall von höchstens 1,4 RGV je Hektar förderfähigen Dauergrünlands des Betriebs entspricht. Bei der Düngemittelbegrenzung ist nicht maßgeblich, welche Tiere gehalten werden, sondern allein die Menge der aufgebrachten Nährstoffe.
c) Pflanzenschutzmittel dürfen nicht angewendet werden. Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann im Einzelfall auf Antrag Ausnahmen zulassen.
Die Dauergrünlandflächen des Betriebs dürfen während des Antragsjahres nicht gepflügt werden. Zur Wiederherstellung der Grasnarbe nach einer Zerstörung durch höhere Gewalt oder außergewöhnliche Umstände kann die nach Landesrecht zuständige Behörde im Einzelfall auf Antrag Ausnahmen zulassen.
Ökoregelung 5 - Ergebnisorientierte extensive Bewirtschaftung von Dauergrünlandflächen mit Nachweis von mindestens vier regionalen Kennarten:
Mit dieser Ökoregelung wird das Vorkommen artenreicher Dauergrünlandflächen gefördert, die durch das Vorkommen von regionaltypischen Kennarten angezeigt werden (ergebnisorientierte Honorierung). Damit wird ein Beitrag zum Erhalt und zur Förderung der biologischen Vielfalt geleistet. Darüber hinaus kann die Öko-Regelung indirekt zu verringerten Stickstoffemissionen mit positiven Wirkungen für den Gewässer- und Klimaschutz beitragen.
Dauergrünlandflächen sind begünstigungsfähig, wenn auf ihnen mindestens vier unterschiedliche Pflanzenarten nachweisbar sind, die auf der Landesliste der Kennarten oder Kennartengruppen für artenreichen Dauergrünlands stehen. Dabei ist über die Mindesttätigkeit hinaus unerheblich, wie das förderfähige Dauergrünland bewirtschaftet wird. Entscheidend ist allein, ob die oben genannten Kennarten tatsächlich auf den Flächen vorkommen. Die Nachweismethode wird ebenfalls auf Landesebene festgelegt. Auch ist es unerheblich, ob die jeweilige Fläche ein geschütztes Biotop ist oder nicht.
Wichtige Hinweise:
Die regionaltypischen Kennarten und Kennartengruppen des artenreichen Grünlandes (§ 17 Absatz 3 Nummer 1 der GAP-Direktzahlungen-Verordnung für die in § 20 Absatz 1 Nummer 5 des GAP-Direktzahlungen-Gesetzes genannte Öko-Regelung) sind in Anlage 1 zur Niedersächsische Verordnung über die Ausführung der Direktzahlungen und des Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystem (NDZInVeKoSAV) festgelegt. Die Liste der Kennarten für ÖR5/GN5 finden Sie unter "Dokumente und Formulare". Dort finden Sie auch den Kartierbogen GN 5 / ÖR 5. Sofern Sie ÖR 5 beantragen, füllen Sie den Kartierbogen aus und halten ihn für den Fall einer Vorort-Kontrolle vor.
Die Kartierung ist von Ihnen selbst oder Bevollmächtigten vorzunehmen. Die Kartierung ist je Schlag anhand der längsten möglichen Geraden, die die betreffende Fläche quert und in zwei etwa gleich große Teile teilt, auf beiden Hälften vorzunehmen. Kennarten auf den ersten 3 m vom Rand des Schlages können nicht berücksichtigt werden.
Eine Beschreibung zum Vorgehen bei der Kartierung finden Sie hier: Webcode: 01042761.
Weiterhin erfolgt eine Überprüfung der Kennarten in 2025 über FANi. Für den Erhalt der Prämie sind die entsprechenden FANi-Aufträge zwingend durch den Antragsteller zu erfüllen.
Ökoregelung 6 - Bewirtschaftung von Acker- und Dauerkulturflächen ohne Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln (PSM):
Mit dieser Ökoregelung werden die reduzierte Anwendung und ein nachhaltiger Umgang mit Pflanzenschutzmitteln gefördert. Damit sollen positive Effekte auf die biologische Vielfalt und auf die Gewässerqualität erreicht werden.
Begünstigungsfähig sind einzelne, vom Begünstigten bezeichnete förderfähige Ackerland- oder Dauerkulturflächen des Betriebs, auf denen keines der festgelegten chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel (PSM) angewendet wird. Es muss nicht das gesamte Ackerland oder alle Flächen einer Kultur in die Öko-Regelung aufgenommen werden. Das heißt, der Begünstigte kann selbst entscheiden, welche Flächen er einbringen möchte, muss dabei aber beachten, dass die Ökoregelung nur für bestimmte Kulturen gilt. Die Zeiträume, in denen die Pflanzenschutzmittelanwendung nicht erlaubt ist, unterscheiden sich nach den Kulturarten. Flächen, für die aufgrund anderer rechtlicher Regelungen bereits ein Verbot der genannten Pflanzenschutzmittel gilt, werden nicht berücksichtigt.
Folgende Kulturen kommen in Betracht:
| Kulturen | Zeitraum, in dem die PSM-Anwendung nicht erlaubt ist | Besonderheiten |
| Sommergetreide (einschließlich Mais, Hirse, Pseudogetreide), Leguminosen (einschließlich Gemenge, außer Ackerfutter) Sommer-Ölsaaten, Hackfrüchte, Feldgemüse | 1. Januar bis zur Ernte, jedoch mindestens bis zum 31. August | Zeitraum endet mit dem Zeitpunkt der letzten Ernte, sofern eine Bodenbearbeitung zur Vorbereitung des Anbaus einer Folgekultur erfolgt, jedoch frühestens zum 31. August |
| Erzeugung von Gras oder anderen Grünfutterpflanzen, als Ackerfutter genutzte Leguminosen (einschließlich Gemenge) | 1. Januar bis zum 15. November | Zeitraum endet vorzeitig mit dem Zeitpunkt der letzten Ernte, sofern eine Bodenbearbeitung zur Vorbereitung des Anbaus einer Folgekultur erfolgt, jedoch frühestens zum 31. August |
| Dauerkulturen | 1. Januar bis zum 15. November |
Ab 2025 kann die Ökoregelung 6 auch für Hirse und Pseudogetreide (z. B. Amaranth, Quinoa, Buchweizen) beantragt werden.
Chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel im Sinne der Ökoregelung 6 sind alle Pflanzenschutzmittel mit Ausnahme von Pflanzenschutzmitteln, die
a) ausschließlich Wirkstoffe enthalten, die als Wirkstoff mit geringem Risiko genehmigt sind nach Artikel 22 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG des Rates (ABl. L 309 vom 24.11.2009, S. 1; L 45 vom 18.02.2020), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2021/383 (ABl. L 74 vom 4.3.2021, S. 7) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung,
b) für die ökologische Landwirtschaft zugelassen sind nach oder aufgrund der Verordnung (EU) Nr. 889/2008 der Kommission vom 5. September 2008 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen hinsichtlich der ökologischen/biologischen Produktion, Kennzeichnung und Kontrolle (ABl. L 250 vom 18.9.2008, S. 1; L 256 vom 29.9.2009, S. 39;L 359 vom 29.12.2012, S. 77), die zuletzt durch die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2021/181 (ABl. L 53 vom 16.2.2021, S. 99) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung.
Zu dieser Ökoregelung bieten die Bundesländer Beratungen an. Eine solche Beratung wird nachdrücklich empfohlen, um die Maßnahme erfolgreich durchzuführen. Darüber hinaus wird auch eine Beratung zum integrierten Pflanzenschutz angeraten.
Ökoregelung 7 - Anwendung von durch die Schutzziele bestimmten Landbewirtschaftungsmethoden auf landwirtschaftlichen Flächen in Natura 2000-Gebieten:
Natura 2000-Gebiete leisten wertvolle Beiträge für Umwelt, Artenschutz und Biodiversität. Die angepasste Bewirtschaftung trägt zur Stärkung dieser Beiträge in solchen Gebieten bei.
Begünstigungsfähig sind förderfähige landwirtschaftliche Flächen in Natura 2000-Gebieten, das heißt in FFH-Gebieten und/oder in Vogelschutzgebieten.
Die Flächen müssen folgende Voraussetzungen erfüllen: Im Antragsjahr dürfen
a) weder (1) zusätzliche Entwässerungsmaßnahmen noch eine (2) Instandsetzung bestehender Anlagen zur Absenkung von Grundwasser oder (3) zur Drainage durchgeführt werden, sowie
b) keine (4) Auffüllungen, (5) Aufschüttungen oder (6) Abgrabungen vorgenommen werden, es sei denn, es handelt sich um eine von einer für Naturschutz zuständigen Behörde genehmigte, angeordnete oder durchgeführte Maßnahme.
Es genügt für die Ökoregelung, wenn mindestens eine der Maßnahmen erlaubt ist. Nur Flächen, bei denen alle sechs der in den Buchstaben a) und b) enthaltenen Voraussetzungen bereits durch andere rechtliche Vorgaben untersagt sind, sind nicht begünstigungsfähig. Dies bezieht sich ausschließlich auf Verbote, die im Rahmen der rechtlichen Sicherung der Natura 2000-Gebiete festgelegt wurden. Dabei ist zu beachten, dass die rechtliche Sicherung in den Bundesländern sehr unterschiedlich erfolgt (Gesetz, Landesverordnung(en), Sammelverordnungen, Schutzgebietsverordnungen).
Steht die Durchführung der oben genannten Voraussetzungen unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde, kann die Ökoregelung in Anspruch genommen werden.
Hier sind die Daten zur Tierhaltung von allen Begünstigten zwingend anzugeben. Diese ist auch wichtig in Bezug auf die ÖR 4, die Fördermaßnahmen für Tiere sowie einzelnen AUKM Maßnahmen.
4.1 Tierhaltung im Antragsjahr
Geben Sie zunächst an, ob Sie Nutztiere halten. Wenn dies zutrifft, beantworten Sie bitte auch die Frage, ob Sie Pferde vorrangig zur Erzeugung von Milch und/ oder Fleisch halten.
Durchschnittlicher Tierbestand des Antragsjahres
Sofern Sie landwirtschaftliche Nutztiere im Betrieb halten, müssen Sie in der Tabelle Ihren voraussichtlichen Jahresdurchschnittsbestand des aktuellen Kalenderjahrs für jede Tierart eintragen. Die Erfassung erfolgt über die Schaltfläche "Tiere hinzufügen". In der Erfassungsmaske können Sie aus der Auswahlliste die jeweilige Tierart auswählen und die Anzahl der Tiere eintragen.
Sonstige Tiere, die zu landwirtschaftlichen Zwecken auf Ihrem Betrieb gehalten oder gezüchtet werden und die nicht gesondert in der Auswahlliste aufgeführt werden, sind unter "Sonstige ldw. Nutztiere" zu erfassen.
Sobald eine Tierart über die Eingabemaske erfasst wurde, können die Angaben über die Tierzahlen direkt in der Tabelle verändert werden.
Tiere löschen: Wenn Sie eine Tierart löschen möchten, markieren Sie die betreffende Zeile in der Tabelle und klicken dann auf die Schaltfläche "Tiere löschen". Die entsprechende Zeile in der Tabelle wird sofort gelöscht.
4.3 ELER-Tierwohl (Sommerweidehaltung)
Antragstellung zur Teilnahme an der Fördermaßnahme Sommerweidehaltung für MilchküheAuch in 2025 können Betriebe mit Betriebssitz in Niedersachsen oder Hamburg eine Förderung der Sommerweidehaltung von Milchkühen beantragen. Voraussetzung für die Förderung ist, dass auch die Tiere in Niedersachsen bzw. Hamburg gehalten werden. Die wesentliche Bedingung für die Gewährung der Prämie ist, dass allen Milchkühen des Betriebes im Zeitraum ab dem 16.05. bis einschließlich 15.09. eine tägliche Weidehaltung von mindestens 6 Stunden gewährt werden muss, soweit Krankheit oder zu erwartende Schäden des Tieres dem nicht entgegenstehen.
Verpflichtungszeitraum 01.01.2025 bis 31.12.2025, Weidezeitraum ab dem 16.05.2025 bis einschließlich 15.09.2025): Unter Ziffer 4.3 beantragen Sie die Teilnahme an der Fördermaßnahme zur Sommerweidehaltung von Milchkühen. Sie müssen bestätigen, dass Sie Milcherzeuger sind. Falls Sie dies verneinen, führt dies zur Ablehnung des Antrages. Die Nachweise über die Milchlieferung Januar bis März (einschließlich) sind bis zum 31.05.2025 bei der zuständigen Bewilligungsstelle der LWK einzureichen. Falls Sie diese zusammen mit dem Datenbegleitschein einreichen, kreuzen Sie bitte „liegen vor“, ansonsten „werden nachgeliefert“ an. Als Nachweise gelten nur Lieferbelege, also entweder Abrechnungen, Screenshots über die Milchlieferung aus dem Lieferantenportal oder Bestätigungen der Molkerei über die Milchlieferung. MLP-Teilnahmebestätigungen reichen nicht aus.
Eine Angabe von Tieren ist hier nicht erforderlich. Die Berechnung der Förderung erfolgt auf Basis der Meldedaten aus der HIT-Datenbank für die im Weidezeitraum gehaltenen Milchkühe.
Die vollständigen Förderbedingungen und weitere Hinweise zu der Fördermaßnahme finden Sie unter https://www.ml.niedersachsen.de/sommerweide.
4.4 Antrag auf gekoppelte Einkommensstützungen
Wenn Sie die gekoppelte Einkommensstützung für Mutterkühe und/oder Schafe/Ziegen beantragen möchten, müssen Sie die entsprechenden Felder unter 4.4.1 und 4.4.2 ausfüllen und am Ende speichern. Die Antragstellung ist bis zum 15. Mai möglich, später eingereichte Anträge werden abgelehnt.
4.4.1 Antrag auf Zahlung für Mutterkühe
Unter Ziffer 4.4.1 können Sie die Prämie für Mutterkühe beantragen. Eine Voraussetzung für die erfolgreiche Antragstellung ist die Registrierung als Rinderhalter bei dem Herkunfts- und Informationssystem für Tiere (HIT). Über „Tierbestand aktualisieren“ werden Ihnen automatisch sämtliche potenzielle Antragstiere aus der HIT mit den dazugehörigen Angaben vorgeblendet. Es werden nur die Mutterkühe angezeigt, die mindestens einmal gekalbt haben. Über die Auswahlbox am linken Rand der Tabelle können Sie nun auswählen, für welches der angezeigten Tiere Sie die Prämie beantragen wollen. Wenn Sie alle angezeigten Tiere beantragen wollen, können Sie die oberste Box anklicken, wodurch automatisch alle Tiere einen Haken erhalten.
Wichtig: Erhält ein Tier keinen Haken wird dieses Tier auch nicht beantragt.
Beachten Sie bei der Beantragung der Mutterkühe die Fördervoraussetzungen:
Es sind mindestens drei Mutterkühe zu beantragen, die während des Zeitraums vom 15. Mai des Jahres, für das die Zahlung beantragt wird, bis zum 15. August desselben Jahres (Haltungszeitraum) im Betrieb gehalten werden und für die im Haltungszeitraum die Pflichten zur Kennzeichnung und Registrierung von gehaltenen Rindern erfüllt sind gem. Teil IV Titel I Kapitel 2 Abschnitt 1 der Verordnung (EU) 2016/429, den Rechtsakten der Europäischen Union, die im Rahmen der genannten Vorschriften und zu deren Durchführung erlassen worden sind oder werden, sowie der Viehverkehrsverordnung. Dem steht nicht entgegen, wenn die Tiere auf Pensions- oder Gemeinschaftsweiden stehen. Betriebe, die Kuhmilch oder Kuhmilcherzeugnisse aus Selbsterzeugung abgeben, sind nicht für die gekoppelte Einkommensstützung der Mutterkühe antragsberechtigt. Die Vermarktung von Kuhmilch oder Milcherzeugnissen anderer Erzeuger ist möglich. Förderunschädlich ist auch die Milcherzeugung ausschließlich für den Eigenverbrauch. Weiterhin sind nur die Tiere förderfähig, die vor Antragstellung mindestens einmal gekalbt haben und die Kalbung in der HIT-Datenbank dokumentiert ist. Die Tiere, für die der Halter nach ViehVerkV ist, aber nicht das wirtschaftliche Risiko trägt (Pensionstiere), dürfen nicht beantragt werden.
Sollten Sie Ihre Tiere in Pension gegeben haben und dementsprechend keine Einträge unter Ihrer Registriernummer erhalten, so ist in diesem Jahr die Einreichung der beantragten Tiere mit dem Datenbegleitschein notwendig. Gleiches gilt für die Tiere, die aufgrund einer Totgeburt in HIT keine Kalbung eingetragen haben. In diesen Fällen ist ein Nachweis über die Totgeburt mit der Antragstellung einzureichen. Alternativ ist auch die Meldung einer Totgeburt in HIT möglich. Bitte nutzen Sie hierfür die Tabellenstruktur wie sie in ANDI abgebildet ist. Auch wenn in diesem Fall keine Tiere in ANDI hinterlegt sind, bestätigen Sie bitte unbedingt den Antrag auf Zahlung für Mutterkühe und speichern diesen.
Bitte beachten Sie auch die Hinweise und Verpflichtungen bei Änderungen (vorzunehmen im Änderungsantrag):
Scheidet eine Mutterkuh aufgrund natürlicher Lebensumstände während des Haltungszeitraum aus dem Bestand aus, kann für dieses Tier grundsätzlich keine Zahlung gewährt werden. Es kann aber unverzüglich durch ein anderes förderfähiges Tier ersetzt werden, für das dann die Zahlung gewährt werden kann. Die Abgangsmeldung und Ersetzung des beantragten Tieres hat innerhalb von 7 Tagen zu erfolgen.
Sofern ein Tier infolge höherer Gewalt oder außergewöhnlicher Umstände ausscheidet, behalten Sie Ihren Anspruch auf Förderung für die Tiere, die zum Zeitpunkt des Eintretens der höheren Gewalt oder der außergewöhnlichen Umstände förderfähig waren. Gem. §14 Abs. 4 GAPInVeKoSG gilt: Fälle höherer Gewalt oder außergewöhnlicher Umstände sind der zuständigen Behörde innerhalb von fünfzehn Werktagen ab dem Zeitpunkt, ab dem der Betriebsinhaber hierzu in der Lage ist, mitzuteilen und nachzuweisen.
Für Mutterkühe, die aus anderen Gründen nicht durchgehend im Haltungszeitraum gehalten werden (z. B. wegen Verkauf/ Schlachtung), wird keine Zahlung gewährt. Der Ersatz durch ein anderes Tier ist in diesen Fällen nicht möglich. Der Antrag ist entsprechend zu ändern. Werden Tiere während des Haltungszeitraums in Pension gegeben, oder findet eine Hofübertragung statt, ist ebenfalls eine entsprechende Änderung im Antrag vorzunehmen und die Registriernummer des Betriebes in der Spalte „Pensionsbetrieb“ einzufügen.
4.4.2 Antrag auf Zahlungen für Mutterschafe und/oder -ziegen
Unter Ziffer 4.4.2 können Sie die Prämie für Mutterschafe/-ziegen beantragen. Bei der gekoppelten Mutterschaf- und -ziegenprämie entfällt ab dem Antragsjahr 2025 die Stichtagsregelung zum 01.01. eines Jahres, nach der maximal die Anzahl Tiere gezahlt werden, die nach der Viehverkehrsverordnung zum Stichtag 01. Januar des Antragsjahres in der Altersklasse ab zehn Monaten in HIT gemeldet wurden. Ferner ist bei der Beantragung der einzelnen Tiere keine Angabe des Geburtsdatums mehr notwendig, das Mindestalter wird gestrichen. Bei den förderfähigen Tieren muss es sich jedoch wie bisher um Muttertiere (Tiere, die zum Antragszeitpunkt aufgrund ihrer altersgerechten Entwicklung die Fortpflanzungsreife erreicht haben) handeln. Ein Bestandsverzeichnis ist im Betrieb vorzuhalten.
Bitte geben Sie an, ob sich die beantragten Tiere während des Haltungszeitraums in Niedersachsen befinden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, kreuzen Sie bitte „Nein“ an.
Über den Button „Tiere einzeln hinzufügen“ können Sie die Tiere zum Antrag hinzufügen. Dazu ist die Angabe der Identifikationsnummer (Ohrmarkennummer) zwingend notwendig. Zusätzlich muss die Betriebsstätte angegeben werden. Sollten Sie die Tiere in Pension gegeben haben, so ist unter „HIT Registriernummer im Haltungszeitraum“ die Registriernummer des Pensionsbetrieb anzugeben. Sobald ein beantragtes Schaf die Ohrmarke verliert und durch eine neue Ohrmarke ersetzt wird, ist die Ersatzohrmarkennummer im Feld „Identifikationsnummer (nach Ohrmarkenersatz)“ einzugeben. Nachdem Sie alle Daten zum Tier eingegeben haben, bestätigen Sie die Eingabe entweder mit „hinzufügen und schließen“, oder benutzen den Button „Weitere hinzufügen“ um das nächste Tier einzugeben.
Alternativ kann eine bereits vorgefertigte CSV-Tabelle genutzt werden. Sie finden sowohl eine Anleitung zur Erstellung einer solchen Tabelle, als auch eine fertige Vorlage oben auf der rechten Seite dieser Hilfeseite unter „Anleitung gekoppelte Einkommensstützung“.
Generell gilt für die Nachweispflicht, dass der Geburtsmonat der ab dem 1. März 2022 geborenen Mutterschafe und -ziegen vorzuhalten ist.
Achten Sie bei der Antragstellung darauf, dass bei jedem Tier der Haken in der linken Spalte gesetzt sein muss, für das Sie die Prämie beantragen wollen. Sollten Sie ein Tier eingetragen haben, für das Sie keine Prämie mehr beantragen möchten, können Sie das Tier über das Mülleimer-Symbol auf der rechten Seite der Tabelle entfernen.
Wichtig: Erhält ein Tier keinen Haken wird dieses Tier auch nicht beantragt.
Beachten Sie bei der Beantragung der Schafe/Ziegen die Fördervoraussetzungen:
Förderfähig sind weibliche Schafe und Ziegen, die zum Antragszeitpunkt aufgrund ihrer altersgerechten Entwicklung die Fortpflanzungsreife erreicht haben und während des Haltungszeitraums vom 15. Mai bis 15. August des Antragsjahres im Betrieb gehalten werden und für die im Haltungszeitraum die Pflichten zur Kennzeichnung und Registrierung von gehaltenen Schafen und Ziegen erfüllt sind Teil IV Titel I Kapitel 2 Abschnitt 1 der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit („Tiergesundheitsrecht“) (ABl. L 84 vom 31.3.2016, S. 1; L 57 vom 3.3.2017, S. 65; L 84 vom 20.3.2020, S. 24; L 48 vom 11.2.2021, S. 3; L 224 vom 24.6.2021, S. 42), die zuletzt durch die Delegierte Verordnung (EU) 2018/1629 (ABl. L 272 vom 31.10.2018, S. 11) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, den Rechtsakten der Europäischen Union, die im Rahmen der genannten Vorschriften und zu deren Durchführung erlassen worden sind oder werden, sowie der Viehverkehrsverordnung. Dem steht nicht entgegen, wenn die Tiere auf Pensions- oder Gemeinschaftsweiden stehen. Auch Wanderschafherden werden im Betrieb des Begünstigten gehalten. Es sind mindestens sechs Tiere zu beantragen. Das können auch z. B. vier Mutterschafe und zwei Mutterziegen sein. Wenn Sie nur die gekoppelte Zahlung für die Haltung von Mutterschafen und -ziegen beantragen, also keine förderfähigen Flächen anmelden oder zusätzlich die Mutterkuhprämie beantragen, so wird die Zahlung nur gewährt, wenn sie mehr als 225 Euro beträgt.
Bitte beachten Sie auch die Hinweise und Verpflichtungen bei Änderungen (vorzunehmen im Änderungsantrag):
Scheidet eine Ziege oder ein Schaf aufgrund natürlicher Lebensumstände während des Haltungszeitraum aus dem Bestand aus, kann für dieses Tier grundsätzlich keine Zahlung gewährt werden. Es kann aber unverzüglich durch ein anderes förderfähiges Tier ersetzt werden, für das dann die Zahlung gewährt werden kann. Der Abgang und Ersatz eines Tieres ist unverzüglich (innerhalb von 14 Tagen) in ANDI zu melden und der Antrag dementsprechend abzuändern. Wird ein abgegangenes Tier nicht abgemeldet und es kommt zu einer Kontrolle, zählt dies als Verstoß.
Sofern ein Tier infolge höherer Gewalt oder außergewöhnlicher Umstände ausscheidet, behält der Betriebsinhaber seinen Anspruch auf Förderung für die Tiere, die zum Zeitpunkt des Eintretens der höheren Gewalt oder der außergewöhnlichen Umstände förderfähig waren. Gem. §14 Abs. 4 GAPInVeKoSG gilt: Fälle höherer Gewalt oder außergewöhnlicher Umstände sind der zuständigen Behörde innerhalb von fünfzehn Werktagen ab dem Zeitpunkt, ab dem der Betriebsinhaber hierzu in der Lage ist, mitzuteilen und nachzuweisen.
Für Mutterschafe oder -ziegen, die aus anderen Gründen nicht durchgehend im Haltungszeitraum gehalten werden (z. B. wegen Verkauf/ Schlachtung), wird keine Zahlung gewährt. Der Ersatz durch ein anderes Tier ist in diesen Fällen nicht möglich. Der Antrag ist entsprechend zu ändern und das Tier zurückzuziehen.
Werden Tiere während des Haltungszeitraums in Pension gegeben, oder findet eine Hofübertragung statt, ist ebenfalls eine entsprechende Änderung im Antrag vorzunehmen und die Registriernummer des Betriebes in der Spalte „Pensionsbetrieb“ einzufügen.
Die Gewährung von Agrarzahlungen ist neben der Beachtung der jeweiligen Fördervoraussetzungen auch geknüpft an die Einhaltung von Vorschriften in den Bereichen Klima und Umwelt, öffentliche Gesundheit und Pflanzengesundheit sowie Tierschutz.
Diese Verknüpfung wird als "Konditionalität" bezeichnet. Mit der Konditionalität werden das bisherige System der Cross Compliance und Verpflichtungen aus dem Greening in geänderter und erweiterter Form fortgeführt. Die Anforderungen, die die Konditionalität umfassen und die im Einzelnen von den Begünstigten einzuhalten sind, werden als Grundanforderungen an die Betriebsführung (GAB) und Standards für die Erhaltung von Flächen in gutem landwirtschaftlichen Zustand (GLÖZ) definiert.
Ausführliche Informationen zum konkreten Inhalt der grundlegenden Verpflichtungen werden in der Informationsbroschüre zur Konditionalität dargestellt. Die Informationsbroschüre finden Sie unter "Dokumente und Formulare". Hinweise dazu, welche Punkte Sie für die Einhaltung der einzelnen GLÖZ beachten müssen finden Sie zudem in der Flächenbearbeitung.
5.1 Lagerstätten für Mineralöle, Treibstoffe und/oder Pflanzenschutzmittel
Beantworten Sie hier die Fragen nach Lagerstätten für Mineralöle und Treibstoffe bzw. für Pflanzenschutzmittel.
5.2 Ausbringung von KlärschlammBeantworten Sie die Fragen, ob Sie in 2024 Klärschlamm ausgebracht haben bzw. ob Sie in 2025 Klärschlamm ausgebracht haben oder beabsichtigen, dieses noch zu tun.
5.3 Aufnahme von Wirtschaftsdünger
Beantworten Sie die Fragen, ob Sie 2024 Wirtschaftsdünger (inkl. Gärreste aus Biogasanlagen) von anderen Betrieben aufgenommen haben bzw. ob Sie 2025 Wirtschaftsdünger (inkl. Gärreste aus Biogasanlagen) aufgenommen haben oder beabsichtigen, dieses noch zu tun.
5.4 Anwendung von bestimmten organischen Dünge- oder Bodenverbesserungsmitteln aus oder mit Materialien tierischen UrsprungsHier geht es, in Zusammenhang mit der Verordnung (EG) Nr. 142/2011, um die Anwendung von bestimmten organischen Dünge- oder Bodenverbesserungsmitteln aus tierischen Erzeugnissen, wie Fleisch oder Fleischknochenmehl oder unter Einsatz von Schlachtabfällen erzeugte Gärreste. Davon nicht betroffen ist die Ausbringung von Gülle, Jauche, Stallmist und Gärresten aus NaWaRo-Anlagen.
Die Angaben werden für Kontrollaufgaben der Landwirtschaftskammer Niedersachsen als Düngebehörde bzw. des Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) als Futtermittelüberwachungsbehörde verwendet.
5.5 Mischung von Futtermitteln unter Verwendung von Zusatzstoffen für den eigenen Bedarf
Hier geht es um das eigenverantwortliche Mischen von Futtermitteln für die Verfütterung im eigenen Betrieb. Die Frage ist mit "Ja" zu beantworten, wenn Sie Futtermittelzusatzstoffe (z. B. Propionsäure zur Getreidekonservierung) oder Vormischungen, die Futtermittelzusatzstoffe enthalten (z. B. Vormischungen mit Konservierungsstoffen, die über das Tränkwasser oder Flüssigfütterungssystem verabreicht werden), verwenden. Ausgenommen sind in diesem Zusammenhang Silierzusatzstoffe.
Die Angabe wird für Kontrollaufgaben der Landwirtschaftskammer Niedersachsen als Düngebehörde bzw. des Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) als Futtermittelüberwachungsbehörde verwendet. Die Beantwortung der Abfrage ist freiwillig.
5.6 Teilnahme an Betriebsberatungs-/Zertifizierungssystemen
Die Frage nach der Teilnahme an Zertifizierungssystemen ist nur dann mit "Ja" zu beantworten, wenn die Zertifizierungssysteme die für die Konditionalität relevanten Anforderungen und Normen beinhalten. Zu Ihrer Orientierung sind in Betracht kommende Zertifizierungssysteme, wie "Qualität und Sicherheit" (QS-System), "International Food Standard" (IFS) und "British Retail Consortium" (BRC) aufgeführt. Sofern Ihr Betrieb ausschließlich als Ökobetrieb nach der Verordnung (EU) 2018/848 anerkannt ist und Sie an keinem weiteren Zertifizierungssystem teilnehmen, so ist die Frage mit "Nein" zu beantworten.
Wenn sie die Frage mit "Ja" beantworten, ist im Weiteren anzugeben, ob der gesamte Betrieb oder nur Teile Ihres Betriebs der Zertifizierung unterliegen.
5.7 Wasserentnahme zur Bewässerung von Flächen
Geben Sie hier an, ob Sie zur Bewässerung Ihrer landwirtschaftlicher Flächen Wasser aus oberirdischen Gewässern oder aus dem Grundwasser im Sinne der §§ 8 und 9 des Wasserhaushaltsgesetzes entnehmen oder beabsichtigen, dieses noch im Laufe des Jahres zu tun.
Soziale Konditionalität
Ab 2025 ist die Gewährung von Agrarzahlungen auch an die Einhaltung von Vorschriften in Hinblick auf bestimmte Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen oder Arbeitgeberverpflichtungen geknüpft. Diese Verknüpfung wird als "soziale Konditionalität" bezeichnet. Die hierzu bestehenden Bestimmungen können Sie in der entsprechenden Informationsbroschüre einsehen (s. hierzu "Dokumente und Formulare").
Beantragung von Flächen in anderen Bundesländern
Für Betriebe mit Flächen in mehreren Bundesländern: es muss auf verschiedene Datensysteme für die Beantragung des Sammelantrages auf Agrarförderung zugegriffen werden. mehrKulturabhängige Angaben
Bei den kulturabhängigen Angaben handelt es sich um einen Übersichtsbereich. Die von Ihnen in der Flächenbearbeitung an den einzelnen Teilschlägen gemachten kulturabhängigen Angaben werden hier zusammenfassend dargestellt. Nur zu einigen Punkten sind hier Angaben möglich und nötig. Auf diese wird gesondert hingewiesen.
Flächen, auf denen Hanf angebaut wird, können förderfähig sein, wenn zum Anbau zertifiziertes Saatgut von Hanfsorten verwendet wird, die am 15. März des jeweiligen Jahres im "Gemeinsamen Sortenkatalog für landwirtschaftliche Pflanzenarten" aufgeführt sind. Wenn bei Kontrollen in zwei aufeinanderfolgenden Jahren festgestellt wurde, dass der Tetrahydrocannabinolgehalt einer Sorte mehr als 0,3% beträgt, darf diese Sorte nicht mehr im Rahmen der Direktzahlungen angebaut werden. Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung macht diese Hanfsorten vor dem 1. Januar des Antragsjahres im Bundesanzeiger bekannt. Beim Anbau von Hanf sind die Vorschriften des Betäubungsmittelgesetzes zu beachten. Die zulässigen Sorten und weitere Hinweise zum Anbau von Nutzhanf finden Sie auch hier: www.ble.de/DE/Themen/Landwirtschaft/Nutzhanf/nutzhanf_node.html.
Die Ziffer 6.1 dient der Übersicht über die von Ihnen gemachten Angaben zum Anbau von Nutzhanf. Ein Bearbeiten der Angaben ist hier nicht möglich, wenn Änderungen vorgenommen werden sollen, muss dies in der Flächenbearbeitung erfolgen.
Sofern Sie Nutzhanf als Hauptkultur anbauen, sind die entsprechenden Flächen in der Schlag- und Teilschlagbearbeitung in der Spalte „Kultur“ als Hanf (Nutzungscode 701) oder als Pflanzenmischung mit Hanf (Nutzungscode 866) zu codieren. Weiterhin sind dort im Karteireiter „Hanf / Mischkulturen / Besondere Erklärungen (EFN)“ jeweils Angaben zu Sorte und Aussaatstärke zu machen.
Wenn Sie Nutzhanf als Nebenkultur anbauen, markieren Sie im Karteireiter „Hauptangaben / ÖR / AUKM“ die Box "Flächenspezifische Angaben" und wählen als Zusatzangabe "65 Zwischenfrucht mit Hanfanteil" aus. Im Karteireiter „Hanf / Mischkulturen / Besonderer Erklärungen (EFN)“ sind zu diesen Flächen dann jeweils Angaben zu Sorte und Aussaatstärke zu machen.
Sofern Sie Direktzahlungen für Flächen beantragen, auf denen Nutzhanf angebaut werden soll, sind die Saatgutetiketten gemeinsam mit der Anlage 1 der BLE (Anzeige des Anbaus von Nutzhanf) mit dem Sammelantrag elektronisch einzureichen. Da die BLE diese Unterlagen ebenfalls benötigt und Sie verpflichtet sind, zumindest die Anbauanzeige direkt elektronisch dort einzureichen, bietet es sich an, beide Unterlagen zusammen an die BLE und die zuständige Bewilligungsstelle zu mailen. Die E-Mailadresse der zuständigen Bewilligungsstelle können Sie der Anlage zur Information nach Art. 13 DSGVO entnehmen (zu finden unter "Dokumente und Formulare"), für die Kontaktaufnahme mit der BLE nutzen Sie bitte: nutzhanf@ble.de
Die folgenden Fristen sind zu beachten:
Wird der Nutzhanf als Hauptkultur (NC 701, 866) angebaut und eine Aussaat des Nutzhanfs ist bei der Abgabe des Sammelantrags bereits erfolgt, sind die Etiketten des verwendeten Saatgutes sowie die Anlage 1 der BLE bis spätestens zum 31.05. des Antragsjahres bei der zuständigen Bewilligungsstelle der Landwirtschaftskammer Niedersachsen einzureichen. Erfolgt die Aussaat des Nutzhanfes erst nach Abgabe des Sammelantrages, müssen die amtlichen Etiketten bis spätestens zum 30.06. bei der zuständigen Bewilligungsstelle eingereicht werden.
Falls der Nutzhanf als Nebenkultur nach dem 30.06. des Antragsjahres angebaut wird ("65 Zwischenfrucht mit Hanfanteil"), müssen die amtlichen Etiketten bis spätestens zum 01.09. bei der zuständigen Bewilligungsstelle vorliegen. Falls entgegen der Angabe im Hauptantrag nach der Hauptkultur doch kein Hanf oder eine Mischung mit Hanfanteil als Zwischenfrucht ausgebracht wird, ist dies über einen Änderungsantrag bis spätestens zum 30.09. mitzuteilen.
Eine fehlende bzw. zu späte Vorlage der Saatgut-Etiketten führt zur Aberkennung der Fläche, dies gilt auch für Hanf/Hanfmischungen als Zwischenfrucht.
Hinweis: Die Abgabe der Erklärung über die Aussaatflächen von Nutzhanf durch die Angaben im Sammelantrag entbindet nicht von der Verpflichtung die Anlage 1 der BLE (Anzeige des Anbaus von Nutzhanf gemäß § 32 Abs. 1 Konsumcannabisgesetz-KCanG) bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) elektronisch vorzulegen. Jeder Anbau von Nutzhanf (auch als Zwischenfrucht), auch wenn dafür keine Beihilfe beantragt wird, ist der BLE zur Erfüllung ihrer Aufgaben bis zum 1. Juli des Anbaujahres mit dem dafür vorgesehenen amtlichen Formular "Anzeige des Anbaus von Nutzhanf" anzuzeigen.
Zu den besonderen Bedingungen zum Anbau von Nutzhanf wird auf die entsprechenden Merkblätter der BLE verwiesen. Diese sind im Internet unter www.ble.de abrufbar.
6.2 Angaben zu Kurzumtriebsplantagen
Die von Ihnen gemachten Angaben aus der Flächenbearbeitung werden hier als Übersicht dargestellt, ein selbständiges Ausfüllen ist nicht möglich. In der Flächenbearbeitung ist zu den entsprechenden Teilschlägen/Schlägen mit dem Nutzungscode 841 (Kurzumtriebsplantagen) das Jahr der Anlage sowie das Jahr der zuletzt erfolgten Ernte zu erfassen. Diese Angaben tragen Sie bitte in der Flächenbearbeitung unter dem Reiter „Grünland / KUP“ ein.
6.3 Förderung der Erstaufforstung
Im Hinblick auf die Erstaufforstung ist es für die Prüfung von Doppelförderungen erforderlich, die Beantragung der forstlichen Förderung auch im Sammelantrag anzuzeigen. Dies geschieht seit 2020 über die Flächenbearbeitung, die Angaben unter Ziffer 6.3 dienen der Übersicht.
Die entsprechenden aufgeforsteten bzw. aufzuforstenden Flächen müssen in diesen Fällen in der Schlag- und Teilschlagbearbeitung mit dem Nutzungscode 564 ("Erstaufforstung mit EAP" bzw. "Nicht landwirtschaftliche, aber §11 (1) Nr.3 Bst. c) der GAPDZV förderfähige Fläche (Aufforstungsverpflichtung nach VO 1257/1999 oder VO (EG) Nr. 1698/2005 oder VO 1305/2013 oder VO 2021/2115 oder bei Eingehung damit in Einklang stehender öffentlich finanzierter Maßnahme aufgeforstete Fläche") aufgeführt werden.
Die aufgeforsteten bzw. aufzuforstenden Flächen sind nur beihilfefähig, wenn die entsprechenden Flächen im Jahr 2008 zur Aktivierung von Zahlungsansprüchen beantragt waren und der Verpflichtungszeitraum für die Förderung der Erstaufforstung noch nicht abgeschlossen ist.
Durch die Beantragung der Direktzahlungen durch die aufgeforstete Fläche entfällt jedoch der Anspruch auf Erhalt der forstlichen Förderung in dem Jahr.
Sollten Sie für Ihre Erstaufforstungsfläche keinen Antrag auf Erstaufforstung gestellt haben bzw. liegen die Vorgaben für die Erstaufforstung nicht vor, codieren Sie diese Fläche bitte mit dem Nutzungscode 955 „Forstflächen (Waldbodenflächen)“.
Die von Ihnen gemachten Angaben in der Flächenbearbeitung in dem Karteireiter „Hanf / Mischkulturen / Besondere Erklärungen (EFN)“ werden hier als Übersicht dargestellt, ein selbständiges Ausfüllen ist nicht möglich.
Auf Flächen mit Mischkulturen, sind die beteiligten Kulturen mit einem Anteil von mindestens 25% gesondert anzugeben. Diese Kulturen sind mit den jeweiligen Prozentanteilen im Karteireiter „Hanf / Mischkulturen / Besondere Erklärungen (EFN)“ anzugeben.
Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen, Ökolandbau, Trinkwasserschutz und AGZ
7.1 Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen, Ökologischer Landbau (Auszahlungsantrag)
+++++ Wichtiger Hinweis zu den Angaben im Betriebsspiegel: +++++
Zum Zeitpunkt des Datenabzuges (Ende Februar 2025) sind ggf. die Auszahlungsanträge noch nicht bewilligt worden. Dies hat zur Folge, dass unter Umständen die vorbelegten Daten im Betriebsspiegel unter "3. Übersicht der Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen, Erschwernisausgleich und Erweiterte Erschwernisausgleich" nicht den aktuellen Stand beinhalten.
7.1.1 Auszahlungsantrag für bestehende Verpflichtungen: Teilnehmer an Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen mit einer gültigen Verpflichtung beantragen unter Ziffer 7.1.1 (Auszahlungsantrag für bestehende Verpflichtungen) die Auszahlung der Zuwendung. Die Beantragung der Auszahlung muss bis zum 15.05.2025 erfolgen. Bei verspäteter Einreichung des Auszahlungsantrages erfolgt eine Kürzung für jeden Kalendertag um 1% des Auszahlungsbetrages. Bei Einreichung des Auszahlungsantrages nach dem 31.05.2025 ist dieser abzulehnen. Weiterhin sind die Fördermaßnahmen anzugeben, für die Sie die Auszahlung beantragen. Die nach unseren Daten gültigen Verpflichtungen stehen Ihnen dabei als Auswahl in der "Liste der Umweltmaßnahmen" zur Verfügung. Wählen Sie die Fördermaßnahmen aus, für die Sie die Auszahlung für bestehende Verpflichtungen beantragen und fügen Sie diese in die Liste "Ihre Auswahl" hinzu.
Durch einen Klick auf die grüne Schaltfläche ">>" fügen Sie alle vorgegebenen Fördermaßnahmen Ihrer Auswahl hinzu. Einzelne Maßnahmen können durch einen Doppelklick mit der linken Maustaste auf die betreffende Fördermaßnahme ausgewählt werden. Alternativ können Sie die betreffende Fördermaßnahme durch einen einfachen Klick mit der linken Maustaste markieren und dann mit einem Klick auf die grüne Schaltfläche ">" Ihrer Auswahl hinzufügen. Es ist auch möglich mehrere Fördermaßnahmen gleichzeitig zu markieren. Halten Sie hierzu die Taste "Strg" gedrückt und markieren die betreffenden Fördermaßnahmen durch einen Klick mit der linken Maustaste. Das Entfernen von Fördermaßnahmen aus Ihrer Auswahl funktioniert entsprechend umgekehrt zu den aufgeführten Möglichkeiten.
Bei flächenbezogenen Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen sind zusätzlich in der Flächenbearbeitung zu den betreffenden Schlägen bzw. Teilschlägen die erforderlichen Angaben bezüglich der Fördermaßnahmen zu machen.
7.2 Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen, Ökologischer Landbau (neue Verpflichtungen) und/oder Erhöhung einer bestehenden Verpflichtung)
Für die Antragstellung 2025 gelten folgenden Einschränkungen:
Für Betriebe mit Betriebssitz in Niedersachsen (NI) ist es nur möglich für BV1 einen Erst-, Folge- oder Neuantrag und für folgende Maßnahmen einen Folgeantrag mit der Restlaufzeit für die bestehenden Verpflichtung zu beantragen:
BV 3, AN 1, AN 2, AN 4, AN 5, AN 6, AN 7, AN 8, AN 9, BF 1, BF 2, BK 1, GN 1, GN 2, GN 3, GN 4, GN 5 (GN 56 sowie GN 58), BB 1, BB 2
In den Maßnahmen AN 2 und AN 8 können jedoch jeweils maximal 10 ha,
in der Maßnahme AN 7 maximal 20 ha,
in der Maßnahme BF 1 maximal 10 ha,
in der Maßnahme BF 2 maximal 3 ha, (Ausnahme: Für Teilnehmer und Teilnehmerinnen am Bundesprogramm Biologische Vielfalt des Bundesamtes für Naturschutz in den Projektgebieten Göttingen und Dümmer gibt es keine Flächenbegrenzung)
in der Maßnahme GN 1 maximal 30 ha,
insgesamt zur bereits bestehenden Verpflichtung beantragt werden.
Für Betriebe mit Betriebssitz in Bremen (HB) ist es nur möglich für BV1 einen Erst-, Folge- oder Neuantrag und für folgende Maßnahmen einen Folgeantrag mit der Restlaufzeit für die bestehenden Verpflichtung zu beantragen:
BV 3, AN 2, AN 8, AN 9, BF 2, BK 1, GN 1, GN 2, GN 4, GN 5 (GN 56 sowie GN 58)
In der Maßnahme BF 2 können jedoch maximal 3 ha insgesamt zur bereits bestehenden Verpflichtung beantragt werden.
Für Betriebe mit Betriebssitz in Hamburg (HH) ist es nur möglich für BV1 einen Erst-, Folge- oder Neuantrag und für folgende Maßnahmen einen Folgeantrag mit der Restlaufzeit für die bestehenden Verpflichtung zu beantragen:
BV 1, AN 2, AN 8, BF 1, BF 2, GN 5 (GN 56 sowie GN 58), BK 1.
Bei BF 1 und BF 2 kann keine Bewilligung für den Zuschlag A erfolgen.
Alle benannten Flächenbegrenzungen gelten für Folgeanträge inclusive der bereits bestehenden Verpflichtung, d. h. die Flächenbegrenzung gilt pro Begünstigten. Zum Beispiel kann ein Begünstigter aus Niedersachsen im Folgeantrag AN 7 nur für 5 ha weitere Flächen beantragen, wenn in der laufenden Verpflichtung AN7 bereits für 15 ha eine Bewilligung besteht.
7.2.1 Antragstellung für neue Verpflichtungen und / oder Erhöhung einer bestehenden Verpflichtung:
Seit 2020 können Sie die Anträge für neue Verpflichtungen (ehemals Hauptantrag) elektronisch stellen. Wenn eine neue Teilnahme an Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen oder die Erweiterung einer bestehenden Verpflichtung beantragt werden soll, erfolgt dies unter Ziffer 7.2.1. Die Beantragung einer neuen Verpflichtung und / oder Erhöhung einer bestehenden Verpflichtung muss zwingend bis zum 15.05.2025 erfolgen. Bei Einreichung des Antrages nach dem 15.05.2025 wird dieser abgelehnt.
Bei lagegenauen Verpflichtungen sind die Flächen, auf denen die Verpflichtung erbracht werden soll, zuvor in der Flächenbearbeitung aufzuführen bzw. entsprechend zu kennzeichnen. Entsprechend werden Ihnen dann die Summen der beantragten Flächen zu jeder lagegenauen Maßnahme hier angezeigt.
Bei den nicht lagegenauen Maßnahmen (BF1, AN2, AN5, AN8 ) geben Sie bitte die zu bewilligende Fläche in ha an.
Je nach Fördermaßnahme sind zusätzliche Anlagen in Papier auszufüllen und dem Antrag beizufügen. Dazu finden Sie jeweils einen Link zur Anlage unter 7.2.2.
Die Übersicht der betreffenden Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen, die in 2025 angeboten werden, finden Sie ebenfalls unter dem Menüpunkt Extras / Dokumente zum Herunterladen. Weitere Informationen können Sie auch der Internetseite https://www.aum.niedersachsen.de entnehmen.
Wichtiger Hinweis zur Kombination von Ökoregelungen (ÖR) mit Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) der alten und neuen Förderperiode:
Bitte beachten Sie bei der Beantragung von Ökoregelungen auf Flächen mit bewilligten AUKM, dass die Kombinierbarkeit ggf. nicht gegeben ist. Dies kann zu Abzügen, Ablehnungen oder Rückforderungen bei den AUKM führen. Eine Darstellung der Kombinationsmöglichkeiten finden sie ebenfalls unter https://www.aum.niedersachsen.de
Bitte informieren Sie sich.
7.3 Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen, Ökologischer Landbau (Bewirtschafterwechsel, Auszahlungsantrag)
Geben Sie hier bitte "Ja" an, wenn seit der letzten Antragstellung ein anzeigepflichtiger Bewirtschafterwechsel erfolgt ist. Gleichzeitig beantragen Sie als Übernehmer unter diesem Punkt die Auszahlung der übernommenen Maßnahmen.
In der Liste "Ihre Auswahl" sind die Fördermaßnahmen anzugeben, für die der anzeigepflichtige Bewirtschafterwechsel erfolgt ist. Die möglichen Umweltmaßnahmen stehen Ihnen dabei als Auswahl in der "Liste der Maßnahmen" zur Verfügung. Wählen Sie die Fördermaßnahmen aus, die übernommen werden sollen und fügen Sie diese in die Liste "Ihre Auswahl" hinzu. Die Vorgehensweise wird unter Ziffer 7.1.1 beschrieben.
Bei flächenbezogenen Verpflichtungen sind die Flächen, auf denen die Verpflichtungen erbracht werden sollen, in der Flächenbearbeitung entsprechend zu kennzeichnen bzw. aufzuführen.
Ein anzeigepflichtiger Bewirtschafterwechsel liegt immer dann vor, wenn die eingegangene Verpflichtung nicht vom Zuwendungsempfänger selbst, sondern ganz oder teilweise durch einen Dritten (mit einer unterschiedlichen Registriernummer) auf dessen Risiko fortgesetzt werden soll (z. B. Hofübergabe, Gründung oder Auflösung einer GbR, Pacht von einzelnen Flächen).
Die Verpflichtung kann vollständig (z. B. Hofübergabe) oder teilweise (z. B. Pacht einzelner Flächen) übertragen werden. Ggf. kann der Umfang der Verpflichtung erhöht werden (siehe Übersicht der Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen für 2025). Neben der Angabe in ANDI 2025 ist zusätzlich das Dokument" vollständig auszufüllen und durch den Übergeber und den Übernehmer zu unterschreiben. Den Vordruck können Sie unter dem Menüpunkt Extras / Dokumente herunterladen.
Mit der Anzeige des Bewirtschafterwechsels sind auch Nachweise über den tatsächlichen Zeitpunkt der Übergabe / Übernahme vorzulegen.
Die Übergabe / Übernahme wird nur anerkannt, wenn der Übergang spätestens mit dem Sammelantrag angezeigt wird und dieser bis zum 15.05.2025 der Bewilligungsstelle vorliegt. Soweit Flächen im Zeitraum vom 16.05. bis 31.05.2025 übergeben werden, muss der Übergang für diese Flächen bis zum 31.05.2025 bei der Bewilligungsstelle angezeigt werden. Erfolgt die Meldung des Bewirtschafterwechsels nicht innerhalb der o. g. Fristen oder werden nicht alle erforderlichen Unterlagen bzw. Unterschriften eingereicht, führt dies zur Ablehnung der Übergabe / Übernahme. In diesem Fall wären bereits geleistete Zahlungen zu erstatten.
7.4 Teilnahme an freiwilligen Vereinbarungen im Trinkwasserschutz
Wenn Sie an den freiwilligen Vereinbarungen im Trinkwasserschutz bereits teilnehmen bzw. zukünftig teilnehmen möchten, sind beide Abfragen unter Ziffer 7.4 mit "Ja" zu beantworten. Vereinbarungen zum Trinkwasserschutz werden für bestimmte Gebiete durch die Wasserversorger, die Beratung zum Gewässerschutz bzw. durch den Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) abgeschlossen.
Die allgemeinen Daten des Sammelantrags sowie die Angaben zu den bewirtschafteten Flächen in der Schlag- und Teilschlagbearbeitung werden zum Abgleich mit der freiwilligen Vereinbarung und zur Erfüllung von Berichtspflichten gegenüber der EU-Kommission genutzt. Zusätzlich sollen mögliche Doppelzahlungen mit anderen Förderprogrammen vermieden werden.
Sammelantrag
Zusätzliche Angaben für Ökobetriebe8.1 Identifikation als Ökobetrieb
Hier ist anzugeben, ob Sie einen Ökobetrieb im Sinne der Verordnung (EG) Nr.2018/848 bewirtschaften und Ihre gesamte betriebliche Produktion diesen Vorschriften genügt.
Bitte geben Sie an, seit wann Sie Ökobetrieb sind und geben SIe den Namen und die Nummer der Ökokontrollstelle an, bei der Sie angemeldet sind.
Sofern Sie einen Ökobetrieb bewirtschaften, müssen Sie die von der Ökokontrollstelle zugeordnete EG-Öko-Kontrollnummer angeben. Wenn Sie im Vorjahr eine EG-Öko-Kontrollnummer angegeben haben, wird diese hier vorgegeben. Falls diese Ökokontrollnummer nicht mehr aktuell ist (z. B. durch Wechsel der Ökokontrollstelle), vermerken Sie bitte die neue Ökokontrollnummer auf dem Datenbegleitschein. Sollten Sie sich über die BundID oder MUK authentifiziert haben, teilen Sie die neue Ökokontrollnummer bitte bis zum 31.05. der zuständigen Bewilligungsstelle mit.
Bitte beachten Sie, dass die folgenden Felder sind nur editierbar sind, wenn keine Ökokontrollnummer vorgedruckt ist.
Nation: In diesem Feld können keine Änderungen vorgenommen werden.
Bundesland: Hier ist das entsprechende Bundesland auszuwählen.
Nummer: Die restliche Angabe beinhaltet eine Kombination aus Ziffern und Buchstaben.
Im Folgenden ist anzugeben, ob Sie die Anforderungen an die ökologische biologische Landwirtschaft gesamtbetrieblich oder nur für bestimmte Einheiten des Betriebes erfüllen.
Sofern Sie die Anforderungen für die ökologische biologische Landwirtschaft gesamtbetrieblich erfüllen, wählen Sie bitte Ziffer 8.1.1 aus. Hier ist weiterhin von Ihnen anzugeben, ob Ihre gesamtbetriebliche Produktion den Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 2018/848 über den ökologischen Landbau genügt.
Sofern Sie die Anforderungen an die ökologische Landwirtschaft nur für Teilbereiche Ihres Betriebes erfüllen bzw. Einheiten Ihres Betriebes noch konventionell bewirtschaftet werden, wählen Sie bitte Ziffer 8.1.2 aus und markieren die entsprechenden ökologisch bewirtschafteten Einheiten. Die ökologisch bewirtschafteten Schläge sind in der Flächenbearbeitung unter dem 3. Karteireiter "Hanf / Mischkulturen / Besondere Erklärungen (EFN)" unter "Fläche Ökobetrieb (nur bei 8.1.2)" durch Setzen eines Hakens zu markieren.
8.2 Bescheinigung der privaten Ökokontrollstelle
Bitte geben Sie hier an ob Sie eine für das Antragsjahr gültige Bescheinigung einer privaten Ökokontrollstelle nach Artikel 29 der Verordnung (EG) 2018/848 besitzen oder sich zurzeit in der Umstellung befinden und noch keine solche gültige Bescheinigung haben.
8.3 Freiwillige Erklärung von Ökobetrieben zur Nutzung der Antragsdaten für das Kontrollverfahren zum Ökologischen Landbau
Hier ist von Ökobetrieben anzugeben, ob sie damit einverstanden sind, dass Angaben aus diesem Sammelantrag der zuständigen Behörde für den ökologischen Landbau (LAVES) und der Öko-Kontrollstelle zur Verwaltungsvereinfachung des Kontrollverfahrens für den ökologischen Landbau übermittelt werden.
Die Übermittlung beinhaltet neben Registriernummer (Betriebsnummer), Name und Anschrift die Angaben zur Tierhaltung, die Angaben zum Betrieb im Hinblick auf die Einhaltung der anderweitigen Verpflichtungen (Konditionalitäten) sowie die Angaben zu den bewirtschafteten Flächen aus der Schlag- und Teilschlagbearbeitung.
Die Einwilligung zur Datenlieferung kann ohne Folgen verweigert werden oder mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.
9. Antrag auf Erschwernisausgleich für Dauergrünland in Niedersachsen / Erschwernisausgleich in Bremen
Nach der Erschwernisausgleichsverordnung Dauergrünland in Niedersachsen wird den bewirtschaftenden Personen ein monetärer Ausgleich gewährt, wenn die rechtmäßig und nach den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis der Landwirtschaft ausgeübte Nutzung der Flächen zum Zweck der Pflanzenproduktion oder Nutztierhaltung aufgrund der in einer Naturschutzgebietsverordnung geregelten Gebote und nicht mit dem Erlaubnisvorbehalt versehenden Verbote, im Nationalpark ,,Harz‘‘, im Nationalpark ,,Niedersächsisches Wattenmeer‘‘ oder im Gebietsteil C des Biosphärenreservats ,,Niedersächsische Elbtalaue‘‘ durch die entsprechenden Gesetze wesentlich erschwert ist.
Erschwernisausgleich wird auch gewährt für Dauergrünland in einem gesetzlich geschützten Biotop, wenn die Voraussetzung nach § 42 Abs. 5 Satz 4 NNatSchG erfüllt ist und die zum Zeitpunkt der Bekanntgabe nach § 24 Abs. 3 Satz 1 NNatSchG oder nach § 17 Abs. 4 Satz 4 NElbtBRG oder des Eintritts der Bestandskraft einer Anordnung nach § 3 Abs. 2 BNatSchG oder nach § 2 Abs. 1 Satz 3 NNatSchG rechtmäßige und nach den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis der Landwirtschaft ausgeübte Nutzung der Flächen zum Zweck der Pflanzenproduktion oder Nutztierhaltung durch eine Rechtsvorschrift oder Anordnung zum Schutz des gesetzlichen Biotops wesentlich erschwert ist.
Vom 15.03. bis zum 15.05. kann für das aktuelle Antragsjahr der Antrag auf Gewährung des Erschwernisausgleichs für Flächen in Niedersachsen und Bremen elektronisch über ANDI gestellt werden. Flächen, für die Sie den Erschwernisausgleich beantragen, müssen in ANDI unter der Flächenbearbeitung mit den erforderlichen Angaben zur Fördermaßnahme gemeldet werden.
Formulare für förderspezifische Aufzeichnungen (Schlagkartei Erschwernisausgleich) finden Sie auf der Internetseite des SLA unter dem Menüpunkt „Dokumente und Formulare – Antragsunterlagen EA / EEA“
Bei erstmaliger Beantragung von gesetzlich geschützten Biotopen fügen Sie bitte eine Kopie der Mitteilung des Landkreises bzw. der Stadt, aus der die Größe der Fläche sowie die festgelegten Auflagen zur Bewirtschaftung hervorgehen, dem Datenbegleitschein zum Sammelantrag bei. Sollten Sie sich über die BundID oder MUK authentifiziert haben, geben Sie die entsprechende Kopie der Mitteilung des Landkreises bitte bis zum 31.05. bei der zuständigen Bewilligungsstelle ab.
Für Flächen der öffentlichen Hand in Bremen sind die Anlagen A und B zum Erschwernisausgleich bei der zuständigen Bewilligungsstelle der Landwirtschaftskammer Niedersachsen einzureichen. Die betreffenden Anlagen stehen auf der Internetseite des SLA unter dem Menüpunkt „“ zur Verfügung.
Der Erschwernisausgleich für Dauergrünland in Niedersachsen wird nicht gewährt für Flächen an der Nordsee oder den tidebeeinflussten Flussläufen ohne Schutz vor Überflutungen oder Hochwasser und für die eine Entschädigung nach § 68 Absatz 1 bis 3 BNatSchG zu gewähren ist.
Er wird auch nicht gewährt für Flächen in Niedersachsen, deren Grundeigentümer die öffentliche Hand nach § 42 Abs. 6 NNatSchG ist. Ob ein Grundeigentümer zur öffentlichen Hand zählt, können Sie der „Auslegungshilfe zur Herkunft der Flächen“ entnehmen. Dieses Dokument finden Sie ebenso auf der Internetseite des SLA unter dem Menüpunkt „Dokumente und Formulare – Antragsunterlagen EA / EEA“.
Wenn Sie zusätzlich zum Erschwernisausgleich für Dauergrünland in Niedersachsen eine Entschädigung nach § 68 Absatz 1 bis 3 BNatSchG bzw. nach § 42 NNatSchG erhalten, müssen Sie unter Nr. 9 die erste Frage im Sammelantrag mit „Ja“ beantworten. Eine solche Entschädigung ist regelmäßig bei der Unteren Naturschutzbehörde zu beantragen und von dieser zu bewilligen. Ein entsprechender Bescheid ist bei der zuständigen Bewilligungsstelle der Landwirtschaftskammer Niedersachsen einzureichen.
10. Antrag auf Erweiterten Erschwernisausgleich
Hinweise zum Antragsverfahren finden unter dem gesonderten Artikel Erweiterten Erschwernisausgleich.
Antragsabgabe
Das Antragsfristende im Antragsjahr 2025 für die Anträge auf Direktzahlungen (inkl. gekoppelter Tierprämien) und für die Erst -Folge-, Neu- und Auszahlungsanträge der Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen sowie der ELER Tierwohlmaßnahmen ist der 15.05.2025.
Als Tag des Antragseingangs gilt der Zugang des Datenbegleitscheins bei der zuständigen Bewilligungsstelle der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Die Anschrift der Dienststelle ist auf dem automatisiert erzeugten Datenbegleitschein vorgedruckt.
Auch hier noch einmal der Hinweis, dass das Einreichen von Dokumenten, die dem Schriftformerfordernis unterliegen, (z.B. dem Datenbegleitschein) über die Funktion Dokumenten-Upload nicht zulässig ist. Erfolgt das Einreichen auf diesem Weg, gelten die entsprechenden Dokumente nicht als gültig eingegangen. Diese Unterlagen sind weiterhin persönlich, per Post oder Fax bei der zuständigen Bewilligungsstelle einzureichen.
Wenn Sie die Authentifizierung über die BundID oder MUK nutzen, gilt das Datum des erfolgreichen Uploads als Eingangsdatum Ihres Antrags, sofern alle erforderlichen Anlagen ebenfalls vorliegen.
Die ggf. von Ihnen in einem anderen Bundesland bewirtschafteten Flächen müssen ebenfalls spätestens bis zu dem vorgenannten Termin im jeweiligen Belegenheitsland der Flächen beantragt werden.
Nach dem 15.05. ist es noch bis zum 31.05.2025 möglich, Sammelanträge einzureichen oder Änderungen zum Sammelantrag vornehmen (mit Ausnahme der gekoppelten Prämie). Nachmeldungen von Tieren zu den Anträgen der gekoppelten Prämien sind nicht möglich. Jede Direktzahlung ist zu kürzen, sofern der Sammelantrag nach Ablauf des 15.05.2025 eingereicht wird. Der Kürzungsbetrag beträgt für jeden Kalendertag, um den der Antrag verspätet eingereicht wird, ein Prozent der berechneten Direktzahlung. Sammelanträge, deren Datenbegleitscheine nach dem 31.05.2025 bei der zuständigen Bewilligungsstelle eingehen, sind abzulehnen.
Anträge auf die gekoppelten Prämien für Schafe, Ziegen und Mutterkühe, Anträge auf Teilnahme an den Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen, auf Teilnahme an der besonders tiergerechten Schweinehaltung, die nach dem 15.05.2025 eingehen oder erst dann vollständig vorliegen, werden abgelehnt.
Nachweise über das Vorliegen der Fördervoraussetzungen können grds. bis zum 30.09. des Antragsjahres nachgereicht werden. Die Fördervoraussetzungen müssen aber spätestens zum Zeitpunkt der Antragstellung bereits vorgelegen haben.
Die Erfassung ganz neuer (Teil-)Schläge oder (Teil-)Landschaftselemente ist bis zum 31.05.2025 möglich, Änderungen an rechtzeitig beantragten (Teil-)Schlägen oder (Teil-) Landschaftselementen können bis zum 30.09.2025 vorgenommen werden.
Wichtig: Bei den genannten Stichtagen für das Fristende handelt es sich um feste Termine. Diese Termine sind daher unbedingt einzuhalten. Auch wenn sie auf ein Wochenende oder auf einen Feiertag fallen, wird das Fristende nicht auf den nächsten Werktag verschoben.
Authentifizierung über BundID und MUK
Im Zuge der Antragsabgabe können Sie entscheiden, ob sie den bisher bekannten Weg beibehalten möchten und einen Datenbegleitschein einreichen (Abgabe bei der Bewilligungsstelle oder Zusendung per Post oder Fax) oder ob Sie ihren Antrag ohne einen Datenbegleitschein und mittels elektronischer Authentifizierung einreichen. In beiden Fällen beantworten Sie wie gewohnt alle Fragen in ANDI und machen die erforderlichen Angaben. Danach gehen Sie in die Antragsprüfung. Sobald Sie dort den Hinweis erhalten, dass der Antrag abgegeben werden kann, klicken Sie auf „Abgabe“.
Im Rahmen der Antragsabgabe müssen Sie bestätigen, dass Sie folgende Dokumente zur Kenntnis genommen haben: Allgemeine und besondere Erklärungen, Hinweise zum Thema Konditionalität, Informationsblatt zu den Informationspflichten bei der Erhebung personenbezogener Daten nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
Im unteren Bereich der Abgabeseite kann nun gewählt werden, ob der Antrag mit oder ohne Datenbegleitschein abgegeben werden soll. Wird die Abgabe mit Datenbegleitschein gewählt, wird ein Datenbegleitschein generiert, der fristgerecht mit den ggf. erforderlichen Unterlagen wie oben beschrieben einzureichen ist. Bei Auswahl des Buttons „Abgabe ohne Datenbegleitschein“ erscheint ein Hinweisfeld, in dem ausgewählt werden kann, ob die Authentifizierung Ihrer Person über BundID oder Ihres Unternehmens über MeinUnternehmenskonto (MUK) erfolgen soll. Je nach Auswahl werden Sie auf die jeweilige Internetseite weitergeleitet und erhalten dort weitere Anweisungen, um sich zu authentifizieren. Voraussetzung zur Nutzung dieser Authentifizierungsmöglichkeiten ist eine vorherige Registrierung bei MUK oder der BundID.
Als Mindestvertrauensniveau ist die Authentifizierung mittels ELSTER-Zertifikat eingerichtet. Höhere Vertrauensniveaus (Onlinepersonalausweisfunktion) sind freiwillig möglich, niedrigere Vertrauensniveaus (Benutzername/Kennwort) sind aus Sicherheitsgründen unterbunden.
Bei einer Authentifizierung über die BundID oder MUK ist weder beim Hauptantrag noch bei Änderungen das Einreichen eines Datenbegleitscheins erforderlich. Für Unterlagen und/oder Informationen, die sonst mit dem Datenbegleitschein einzureichen sind, gilt in diesen Fällen:
· Änderungen an den Stammdaten sind eigenverantwortlich über das ERNI-Portal vorzunehmen
· Erforderliche Unterlagen/Vordrucke, auf denen die Unterschrift erforderlich ist, sind persönlich, per Post oder Fax bei der zuständigen Bewilligungsstelle einzureichen
Wenn Sie sich bzw. Ihren Betrieb bei der BundID oder MUK registriert haben und sich im Rahmen der Antragsabgabe über diese Plattformen authentifizieren möchten, beachten Sie bitte, dass es sich um personen- bzw. betriebsgebundene Authentifizierung handelt. Falls Sie also in einem Beratungstermin Ihren Antrag mittels Authentifizierung über BundID oder MUK abgeben möchten, sollten Sie Ihren Personalausweis oder ihr ELSTER-Zertifikat bei sich führen, um die Authentifizierung vornehmen zu können.
Bei erfolgreicher Authentifizierung wird der Antrag auf den SLA-Server hochgeladen und ist abgegeben. Neue Anträge innerhalb des Antragszeitraums überschreiben die vorherigen Anträge.
In ANDI können Sie ab Ende April 2025 anhand eines Hakens an der Upload-Datei erkennen, ob Ihr Upload des Sammelantrages erfolgreich war.
Abgabe von Änderungsanträgen
Entsprechend den Vorgaben der EU-Kommission ist das gesamte Agrarförderverfahren seit der neuen Förderperiode einer Qualitätsbewertung zu unterziehen. Dazu gehört auch, dass nachvollziehbar sein soll, warum Antragsangaben im Verlauf verändert werden, um daraus Verbesserungsbedarf ableiten zu können.
Daher ist es erforderlich, dass an den Änderungen dokumentiert wird, warum sie vorgenommen werden. Im Rahmen der Abgabe der Änderungen ist anzugeben, ob die Änderung erfolgt, weil Ihnen eine Änderung angezeigt wurde, die sich aus dem AMS-Verfahren ergeben hat (AMS-Änderung). Diese Option ist zu wählen, wenn Ihnen im Schlag-Info-Portal angezeigt wird, dass seitens der Verwaltung eine Änderung vorgenommen wurde und Sie diese übernehmen möchten. Wird Ihnen angezeigt, dass aufgrund eines von Ihnen angezeigten Feldblock- oder LE-Fehlers oder einer verwaltungsseitig erforderlichen Anpassung eine Referenz oder Feldblocknummer geändert wurde und sich daraus für den gestellten Antrag Änderungsbedarf ergibt, nutzen Sie bitte den Änderungsgrund "Änderung der Referenz/ Feldblocknummer". Sollten Sie aus anderen betriebsbedingten Gründen eine Änderung vornehmen, z.B. weil sich Ihre Planungen geändert haben, wählen Sie bitte "Antragsanpassungen aus betrieblichen Gründen".
Die Hintergründe der vorgenommene Änderungen lassen sich nur durch die Angaben der Antragstellenden ermitteln, so dass wir auf Ihre Mithilfe angewiesen sind.
Veränderungen zu beihilferelevanten Angaben im Sammelantrag Agrarförderung und Agrarumweltmaßnahmen sind unverzüglich anzuzeigen. Durch das Mittel der Selbstanzeige können Sie möglicherweise hohe Kürzungen und/oder Sanktionen, die sich aus versehentlich falschen, vergessenen oder nicht mehr aktuellen Angaben im Antrag ergeben, vermeiden.
Fragen/Antworten/Hilfen
Erläuterungen und Hinweise zur Antragstellung sowie zum Ausfüllen des Sammelantrages erhalten Sie nach der Anmeldung in ANDI 2025 in der Übersicht unter dem Punkt „Dokumente herunterladen“ und unter „Häufig gestellte Fragen (FAQ)“ sowie im gesamten Antrag beim "?" Symbol.
In der Anwendung selbst verbirgt sich hinter jedem „?“ Symbol eine entsprechende Verlinkung zur Hilfe des jeweiligen Themas. Sollten Sie Ihre Problemstellung dort nicht finden, so können Sie die am häufigsten gestellten Fragen von anderen Antragstellenden unter dem Fragen-und-Antworten-Katalog („Häufig gestellte Fragen (FAQ) einsehen.
Darüber hinaus finden Sie am Ende des textlichen Abschnittes ein Kontaktformular, um Ihre Fragen direkt an das technische Service-Team zu senden.
Auskünfte zum Sammelantrag 2025 erteilt Ihnen auch Ihre zuständige Bewilligungsstelle der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Die Kontraktdaten können der Anlage zur Erklärung nach Art. 13 und 14 DSGVO entnommen werden, die Sie unter dem Punkt „Dokumente und Formulare“ finden.
- Aktuelles
- Neu in ANDI 2025
- Technische Voraussetzungen
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Technische Nachrichten
- Änderungsanträge
- Bereinigung Überlappung
- AMS-Änderungsmitteilung
- Agrarumweltmaßnahmen und Ansprechpartner
- Andere Bundesländer
- Termine
- Dokumente und Formulare
- Hilfe
- Schnittstellen der Abgabedateien
- Schlaginfo-Portal